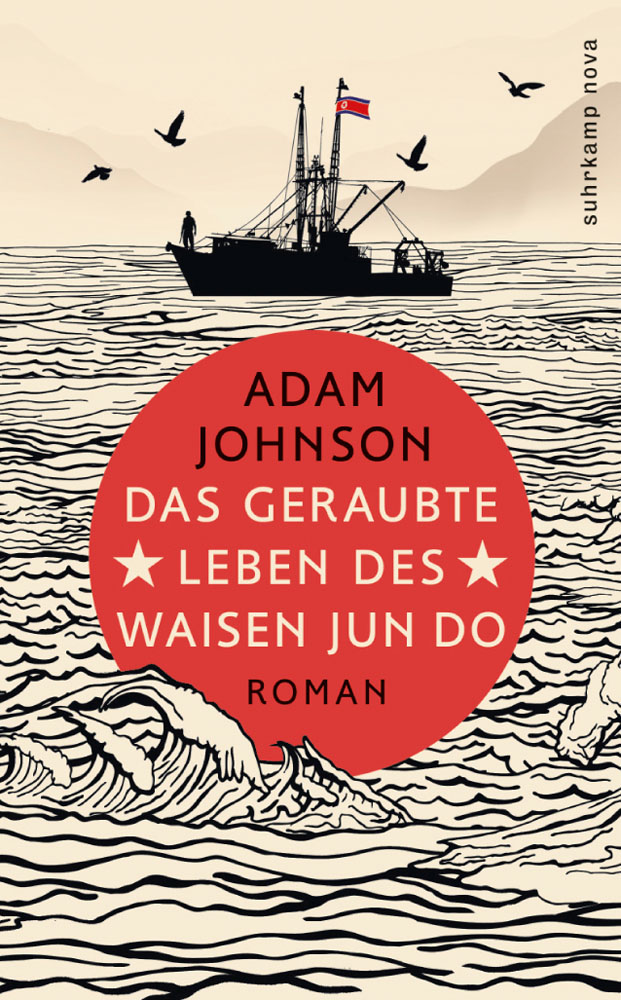![Das geraubte Leben des Waisen Jun Do]()
Das geraubte Leben des Waisen Jun Do
geröstetes Zwiebelgrün, köchelnde Erdnüsse, Hirse in der Pfanne – Abendessen in Pjöngjang. Mir blieb nichts, als nach Hause zu gehen.
Die U-Bahn fuhr nicht, denn ein Großteil des städtischen Stroms wurde derzeit für die industriellen Reistrockenanlagen im Süden abgezogen. Die Warteschlange für den Schnellbus nach Kwangbok war drei Häuserblocks lang. Ich machte mich zu Fuß auf den Weg. Kaum zwei Straßen weiter hörte ich die Megaphone und wusste, dass ich in der Klemme saß. Der Minister für Massenmobilmachung durchkämmte mit seinen Kadern den Stadtbezirk und ließ jeden Bürger einsammeln, der das Pech hatte, sich im Freien aufzuhalten. Allein schon der Anblick der gelben Abzeichen verursachte mir Übelkeit. Weglaufen stand außer Frage – wenn sie nur den leisesten Verdacht bekamen, dass man sich dem »freiwilligen« Ernteeinsatz entziehen wollte, hieß das ab ins landwirtschaftliche Umerziehungslager: ein ganzer Monat Schufterei und Gruppenkritik. Eine Pubjok-Marke konnte einen vor solchen Einsätzen retten; da ich keine mehr hatte, fand ich mich nun auf der Ladefläche eines Lasters wieder – auf dem Weg aufs Land, wo ich sechzehn Stunden lang Reis ernten würde.
Bei Mondlicht fuhren wir Richtung Nordost, auf die Silhouette des Myohyang-Gebirges zu, ein ganzer Kipper voller Stadtmenschen in Bürokleidung – gut hundert waren wir insgesamt. Wenn der Fahrer etwas auf der Straße zu sehen glaubte, schaltete er kurz die Scheinwerfer ein, aber die Fahrbahn war absolut leer – keine Leute, keine Autos – nichts als die leere Schnellstraße. Panzersperren säumten unseren Weg, neben den Kanälen rosteten gigantische chinesische Bagger, die orange lackierten Arme mitten in der Bewegung erstarrt – einfach stehengelassen, Ersatzteile gab es nicht.
Im Dunkeln gelangten wir zu einem Dorf irgendwo am Ch'ongch'on. Da kletterten wir vom Laster und suchten uns einen Schlafplatz im Freien. Mein Kittel würde mich warmhalten, und als Kissen hatte ich meine Aktentasche. Die Sterne schienen allein zu meiner Freude am Himmel zu stehen, und ich genoss es, zur Abwechslung einmal nicht unter einem Dach voller Erde und Ziegen schlafen zu müssen. Fünf Jahre lang hatte ich mich dank meiner Marke vor dem Erntedienst drücken können; ich hatte tatsächlich den Sommergesang der Grillen und Frösche vergessen und den duftenden Nebel, der aus dem Wasser der Reisterrassen aufsteigt. Irgendwo in der Dunkelheit hörte ich spielende Kinder, und ein Mann und eine Frau gaben Geräusche von sich, die wohl vom Geschlechtsakt herrührten. Seit Jahren hatte ich nicht so gut geschlafen wie in dieser Nacht.
Frühstück gab es nicht; ich hatte Blasen an den Händen, noch bevor die Sonne richtig am Himmel stand. Stundenlang tat ich nichts anderes, als Dämme aufzubrechen und wasserführende Kanäle zuzuschütten. Ich hatte keine Ahnung, warum wir von der einen Reisterrasse das Wasser abließen und die nächste fluteten, doch bei Tageslicht wurde unübersehbar, was für ein hartes Leben die Bauern in der Provinz Chagang-do führten. Einer wie der andere trug billige, formlose Kleidung aus Vinalon, an den Füßen hatten sie nichts als schwarze Sandalen, ihre Körper waren spindeldürr, die Haut rissig und dunkel, und ihr Zahnschmelz war so durchsichtig, dass das schwarze Zahnbein hindurchschimmerte. Jede Frau mit nur einem Anflug von Schönheit war in die Hauptstadt verfrachtet worden. Zur Reisernte erwies ich mich offenbar als derart ungeeignet, dass man mir stattdessen auftrug, die Latrineneimer auszuleeren; den Inhalt harkte ich zwischen Lagen von Reishülsen ein. Danach zog ich im Dorf Furchen, die angeblich von Nutzen sein würden, wenn die Regenzeit begann. Eine uralte Frau, zu alt zum Arbeiten, sah mir beim Schaufeln zu. Sie drehte sich mit Maishülsen Zigaretten und erzählte mir viele Geschichten; allerdings hatte sie keine Zähne im Mund und ich verstand kein Wort.
Am Nachmittag wurde eine Städterin von einer gewaltigen, mannsgroßen Schlange gebissen. Auf die Wunde bekam sie einen Breiumschlag. Sie schrie und schrie, und ich wollte sie besänftigen, indem ich ihr über die Haare strich, doch der Schlangenbiss musste etwas in ihr ausgelöst haben – sie schlug mich und stieß mich von sich. Die Bauern hatten inzwischen die sich windende Schlange gefangen: Sie war ebenso schwarz wie das mit Fäkalien vermischte Wasser, in dem sie verborgen gelegen hatte. Manche wollten ihr die Gallenblase entnehmen, andere wollten ihr
Weitere Kostenlose Bücher