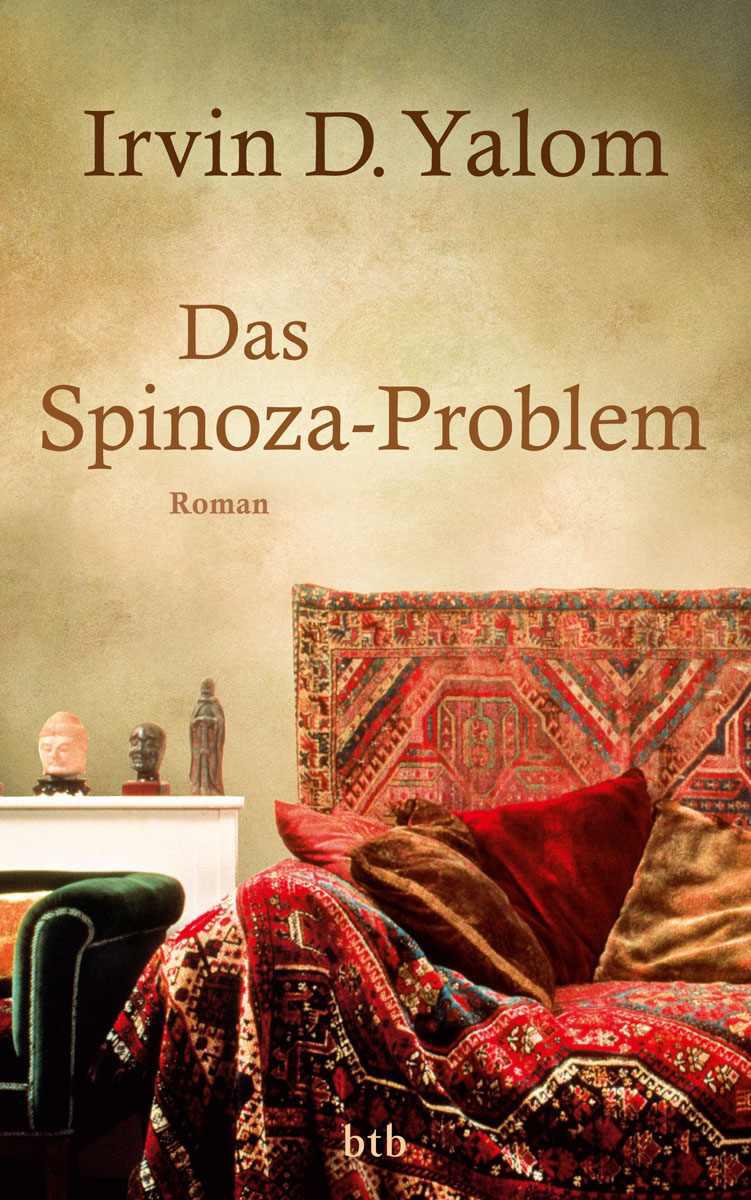![Das Spinoza-Problem: Roman (German Edition)]()
Das Spinoza-Problem: Roman (German Edition)
Sprechzimmer gestürmt war, und er war erleichtert gewesen, ihn nicht mehr wiedersehen zu müssen. Darüber hinaus hatte er versucht, den Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts zu lesen. Aber wie für alle anderen war er auch für ihn unverständlich gewesen. Das Buch gehörte zu den Bestsellern, die alle kauften, aber niemand las. Das Wenige aber, das er las, hatte ihn aufgeschreckt. Alfred leidet vielleicht wirklich, niedergeschlagen gesteht er, dass ich sein einziger Freund sei, aber er ist gefährlich – gefährlich für Deutschland, für alle.
Die Gedanken im Mythus und in Mein Kampf wiesen Parallelen auf – er erinnerte sich, dass Alfred gesagt hatte, Hitler habe ihm seine Ideen gestohlen. Beide Bücher drehten ihm den Magen um – so abscheulich, so gemein waren sie. Und so bedrohlich, dass er an Emigration gedacht und schon an Carl Gustav Jung und an Eugen Bleuler geschrieben hatte, um sich nach einer Stelle am Krankenhaus in Zürich zu erkundigen, wo er sein Praktikum absolviert hatte. Aber dann kam der verfluchte Einberufungsbrief, in dem man ihm zu seiner Ernennung zum Oberleutnant der Wehrmacht gratulierte. Er hätte früher handeln müssen. Sein Analytiker Hans Meyer hatte ihn bereits gewarnt; er hatte Mein Kampf schon mehrere Jahre zuvor an einem Wochenende gelesen, hatte die Katastrophe kommen sehen und anschließend jedem Einzelnen seiner jüdischen Patienten empfohlen, sofort das Land zu verlassen. Er selbst war innerhalb eines Monats nach London emigriert.
Was also tun? Friedrich hatte den naiven Gedanken verworfen, Alfred helfen zu können, ein besserer Mensch zu werden – diese Vorstellung verbuchte er auf seine jugendliche Torheit. Seiner eigenen Karriere (und dem Wohlergehen seiner Frau und seiner beiden kleinen Söhne) zuliebe gab es nur eine gangbare Möglichkeit: den Befehlen Folge zu leisten, sein Bestes zu tun, um Alfred so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus zu holen und dann zurück zu seiner Familie und seinen Patienten an seinen Einsatzort in Berlin zu eilen. Er musste die Verachtung für seinen Patienten begraben und professionell arbeiten. Sein erster Schritt war die Konstruktion eines klaren Therapierahmens.
»Deine Bemerkung über unsere Freundschaft berührt mich«, sagte er. »Aber deine Feststellung, ich sei dein einziger Freund, macht mir auch Sorge. Jeder braucht Freunde und Vertraute. Wir sollten deine Isolation ansprechen: Es besteht kein Zweifel, dass sie eine Hauptrolle bei deiner Krankheit spielt. Was unsere Zusammenarbeit betrifft, will ich dir noch ein paar andere Bedenken mitteilen. Diese sind schwieriger auszudrücken, aber es ist notwendig, sie anzusprechen. Ich habe ebenfalls persönliche Anliegen. Wie du weißt, ist es mittlerweile ein Verbrechen, irgendwelche Standpunkte der Partei in Frage zu stellen. Alles, was man sagt, wird überwacht, und zweifellos wird diese Überwachung im Laufe der Zeit noch zunehmen. Das ist bei autoritären Regimes immer so. Ich bin wie die Mehrzahl der Deutschen nicht mit allen Lehren der NSDAP einverstanden. Du weißt natürlich selbst, dass Hitler nie eine Stimmenmehrheit bekommen hat. Das letzte Mal, als wir uns trafen – das ist jetzt viele Jahre her – sechs Jahre, glaube ich –, bist du aus meinem Sprechzimmer gestürmt, und zwar – erlaube mir, das zu sagen – vor Wut wie von Sinnen. In diesem Zustand könnte ich nicht darauf vertrauen, dass du meine Privatsphäre respektierst. Und das wird dazu führen, dass ich mich eingeschränkt fühle und meine Arbeit mit dir weniger effektiv sein wird. Das ist ziemlich wortreich ausgedrückt, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine: Vertraulichkeit muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Du hast mein persönliches und professionelles Wort, dass alles, was du sagst, hier in diesem Raum bleibt. Und ich brauche die gleiche Sicherheit.«
Beide Männer schwiegen eine Weile, bis Alfred sagte: »Ja, das verstehe ich. Ich gebe dir mein Wort, dass alle deine Bemerkungen vertraulich bleiben. Und ich verstehe auch, dass du dich nicht sicher fühlen kannst, wenn ich die Beherrschung verliere.«
»Richtig. Deshalb müssen wir in einem sichereren Rahmen arbeiten und danach trachten, uns beiden ein Gefühl von Sicherheit zu geben.«
Friedrich sah sich seinen Patienten genauer an. Alfred war unrasiert. Dunkle Säcke unter den Augen legten Zeugnis von schlaflosen Nächten ab, und seine kummervolle Miene appellierte an Friedrichs ärztliche Instinkte: Er verdrängte seine Antipathie und machte
Weitere Kostenlose Bücher