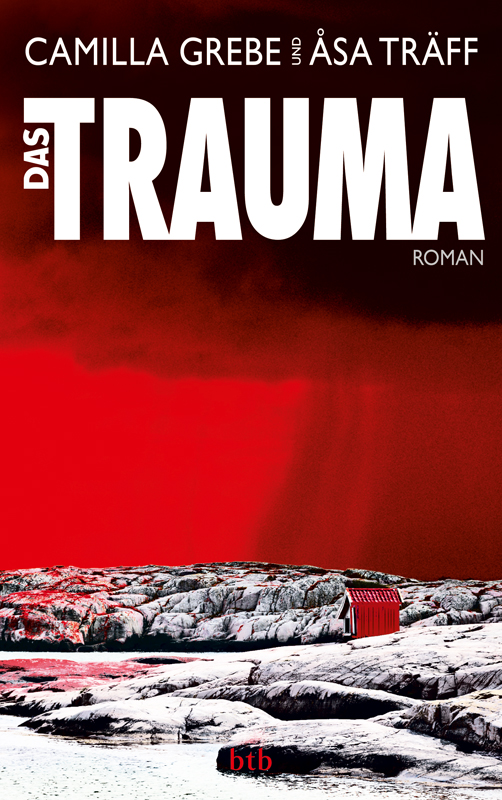![Das Trauma]()
Das Trauma
Familienglück. Als wäre das etwas, das alle haben könnten, wo man nur zuzugreifen braucht. Ungefähr wie der Kauf eines neuen Tischs oder Sofas.
»Markus ist jung, und manchmal ist er so naiv.«
Ich schüttele den Kopf. Schaue in mein fast leeres Weinglas.
»Was, wenn er das nicht ist? Naiv, meine ich?«
Aina schiebt sich eine blonde Locke aus der Stirn und mustert mich forschend.
»Was, wenn du ihm keine Chance gibst, den entscheidenden Schritt nicht wagst?«
Ich schaue sie überrascht an, denn sonst ist sie diejenige, die sich skeptisch über meine Beziehung zu Markus äußert.
»Du bist offenbar ungeheuer verliebt in ihn, und trotzdem bist du feige. Traust dich auf irgendeine Weise nicht, zu eurer Beziehung zu stehen. Ich finde, du solltest dir überlegen, was du wirklich willst, denn du behandelt Markus nicht gerade fair.«
Ich verstehe nicht, was das nun wieder soll. Aina ist sonst immer loyal. Immer auf meiner Seite. Ich will schon widersprechen, aber da stellt mir ein freundlicher Kellner einen Teller mit einer gigantischen Portion Frikadellen hin. Ich seufze und schaue auf, konzentriere mich auf die Spielkarte, die seltsamerweise an der Decke befestigt ist, die dort schon hängt, solange ich mich erinnern kann. Als ich Ainas Blick erwidere, zucke ich mit den Schultern und greife zum Besteck.
Die Diskussion ist beendet.
Ich sitze allein in der Praxis, unterschreibe Krankenberichte und erledige anderen Papierkram. Es ist Abend, und ich müsste nach Hause fahren, zu Abend essen, mit Markus fernsehen. Stattdessen nehme ich mir ein Weingummi. Den ganzen Tag war mir schon vage schlecht, wie ein leichter, aber eindeutiger Kater, als ob eine gemeine Magengrippe in meinem Gedärm auf der Lauer liegt und auf die Möglichkeit zum Losbrechen wartet.
Die Praxis ist stumm, dunkel und einsam. Irgendwo im Zimmer nehme ich den Geruch einer alten Bananenschale wahr, und mein Magen dreht sich um. Nach einigem Suchen finde ich die braune Schale hinter dem Papierkorb. Naserümpfend trage ich sie in die Teeküche und werfe sie in den Mülleimer.
Mein Mobiltelefon klingelt in dem Moment, in dem ich mein Büro wieder betrete. Es ist meine älteste Schwester, die mich an den Geburtstag meines Neffen erinnern will. Sie klingt freundlich und erzählt von einer neuen Stelle und der bevorstehenden Urlaubsreise, aber als sie hört, dass ich noch immer bei der Arbeit bin, ist sie deutlich besorgt.
»Es ist doch schon acht, wie lange willst du denn noch da sitzen bleiben?«
Ich lache, erstaunt über ihre Fürsorge.
»Keine Minute länger als bis neun, aber die Krankenberichte schreiben sich nicht selbst.«
»Ich dachte, für so was hättet ihr Leute.«
Wieder lache ich. Diesmal lauter. Die Vorstellung, dass kleine, vermutlich weibliche Hilfskräfte sich mit Krankenberichten, die geschrieben werden müssen, durch die Praxis schleichen könnten, bringt mich zum Lachen. Wir haben zwar Elin, aber die kann ja kaum den Terminkalender führen. Was passieren würde, wenn sie meine Notizen ins Reine schreiben müsste, wage ich mir nicht einmal vorzustellen. Wörter wie Fehlbehandlung und Ethikkommission tauchen in meinen Gedanken auf.
»Ja, klar, männliche. So um die zwanzig vielleicht. Du weißt, ehe sie übellaunig werden und sich weigern, Kuchen zu kaufen und meine Wäsche aus der Reinigung zu holen.«
Ich ahne, dass sie breit grinst, auch wenn ich sie nicht sehen kann.
Natürlich bleibe ich bis nach neun. Ich renne die Treppe hinunter. Weil ich nicht gern lange in dem dunklen Treppenhaus bleiben will und weil ich bald zu Hause essen möchte.
Der Wind, der mir entgegenschlägt, als ich die Tür öffne, ist womöglich noch eisiger als vorhin. Das ständige Verkehrsdröhnen aus der Götgata liegt wie eine weiche Geräuschdecke über dem Platz. Immer vorhanden, aber absolut nicht störend. Ich ahne die Umrisse von Menschen, die sich in der dichten Dunkelheit scheinbar ziellos über den Medborgarplatz bewegen.
Ziehe im kalten Wind den Kopf ein.
Auf meiner Rechten sehe ich das thailändische Restaurant. Das kleine Neonschild flackert in der Dunkelheit wie ein einsames Irrlicht in der Nacht. Auf der Treppe zur Badeanstalt sitzt eine Gruppe Penner und teilt verbissen eine Flasche.
Langsam nehme ich meine Taschen und gehe zum Geldautomaten, wickele mir den grauen Schal noch einmal mehr um den Hals, in dem Versuch, die feuchtkalte Herbstluft daran zu hindern, unter meinen dünnen Mantel zu kriechen.
Ich sehe ihn fast sofort.
Weitere Kostenlose Bücher