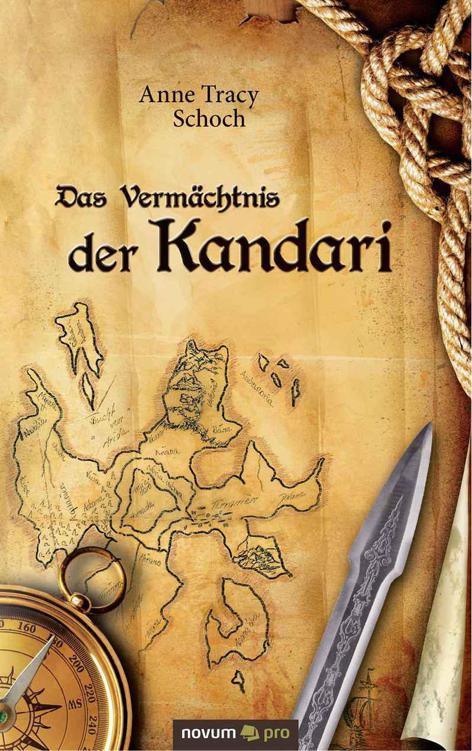![Das Vermächtnis der Kandari (German Edition)]()
Das Vermächtnis der Kandari (German Edition)
Richtung Gebirge. Sie lauern in den Wäldern. Ihr dürft keine Flüchtlinge mehr in diese Richtung schicken, sie wären verloren.“
„Felicius ist vorgestern mit einer Gruppe von Flüchtlingen in diese Richtung aufgebrochen“, murmelte Eugen.
Julius erwiderte seinen Blick aus weit aufgerissenen Augen: „Wie viele?“
„Über hundert, glaube ich. Ein paar Männer, die zu alt sind, um zu kämpfen, Frauen und Kinder. Sie haben keine Chance, wenn die Brochonier sie angreifen.“
„Wir müssen sie warnen“, Elaine, die bisher schweigend zugehört hatte, mischte sich jetzt in ihr Gespräch. Der Anblick des verlassenen Komars stand ihr deutlich vor Augen und das Gefühl der Ungewissheit über das Schicksal ihres Vaters, ihres Volkes hatte sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Aber Eugen schüttelte nur bedauernd den Kopf.
„Das ist unmöglich. Wir könnten nie rechtzeitig da sein.“
„Wir nicht, aber ich könnte es“, drängend sah Julius den Aquarianer-Fürsten an, „ein einzelner Reiter wäre schnell genug, sie einzuholen.“
Er hatte diese Worte kaum ausgesprochen, als Eugen schon entschieden den Kopf schüttelte: „Das ist zu gefährlich. Und besonders du solltest dein Leben nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen. Was würdest du tun, wenn die Brochonier dich angreifen?“
„Ich wäre kaum ein lohnendes Ziel für sie“, Hilfe suchend sah er Elaine an. Sie erwiderte seinen Blick, aber man sah ihr deutlich an, dass sie um Fassung rang.
„Wenn es eine Möglichkeit gibt, sie zu retten, musst du gehen“, sie schniefte und in ihren blauen Augen schimmerten Tränen, „aber ich will dich nicht verlieren.“
Leise schluchzend warf sie sich in seine Arme und klammerte sich an Julius fest. Behutsam strich er durch ich blondes Haar. Vielleicht sah er sie heute tatsächlich zum letzten Mal, überlegte er mit seltsamer Objektivität, aber der Gedanke an den Tod erschien ihm so unendlich weit entfernt und bizarr. Er sah wieder Eugen an. Dieser zuckte mit den Schultern: „Ich kann es dir nicht verbieten. Aber du solltest nicht allein gehen.“
Er winkte zwei Soldaten zu sich und erteilte ihnen ein paar knappe Befehle. Sie gingen, aber schon kurze Zeit später kamen sie mit ihren Pferden und voll bewaffnet zurück. Elaine löste sich aus Julius’ Armen. Sie hatte ihre Selbstbeherrschung wiedererlangt, dennoch zitterte ihre Stimme: „Sei vorsichtig“, flüsterte sie. Sie wollte noch mehr sagen, aber ihre Stimme versagte. Dann stieg Julius auf sein Pferd und ritt gemeinsam mit den beiden Soldaten vom Innenhof der Burg, die breiten Straßen entlang und durch das Stadttor hindurch in die jetzt menschenleere Wildnis.
Während Julius Askana verließ und so schnell wie möglich durch die verschneiten Wälder ritt, bewegte sich Felicius langsam mit den über hundert Menschen in das Landesinnere, ohne zu ahnen, welche Gefahren auf ihrem Weg lauerten. Viele von ihnen waren krank gewesen und es hatte Felicius einige Mühe gekostet, sie alle so weit zu heilen, dass sie die Stadt verlassen und Zuflucht in den Bergen suchen konnten. Jetzt sah er sich um und seufzte. Er tat alles in seiner Macht Stehende und noch immer kamen sie nur schleppend voran. Er fragte sich, wie sie es jemals schaffen sollten. Er wusste, Philipe, der am gleichen Tag wie sie aufgebrochen war, hatte Kontakt mit den Waldläufern aufgenommen und sie ihnen entgegengeschickt, aber selbst bis zum Grenzgebiet waren es noch mindestens zwei Tagesmärsche. Die meisten der Menschen gingen zu Fuß, denn ein Reittier bedeutete einen Luxus, den sich die wenigsten leisten konnten. Auch Felicius hatte sein Pferd einem alten Mann überlassen, der sich nur mühsam und auf einen Stock gestützt bewegen konnte. Dies war die Kehrseite des Krieges, den keiner der Hauptmänner und Strategen, Könige und Kriegsherren zu Gesicht bekam. Sie verschlossen die Augen vor dem Elend der Bevölkerung. Würden sie nur ein einziges Mal daran denken, was sie ihrem Land und ihrem Volk antaten, dachte Felicius voller Zorn, dann würden sie ihre Probleme ohne Gewalt lösen. Dieser Gedanke war nicht gerecht, das wusste er, denn Julien sorgte sich sehr wohl um die Menschen. Andererseits kannten auch Hunger, Leid und Armut keine Gerechtigkeit. Und egal, wie viel er oder irgendjemand anderes tat, sie konnten nicht allen helfen. Es war einfach nicht genug, es würde niemals genug sein.
Er schüttelte den Kopf und fand zurück in die Wirklichkeit. Flüchtig erinnerte sich Felicius
Weitere Kostenlose Bücher