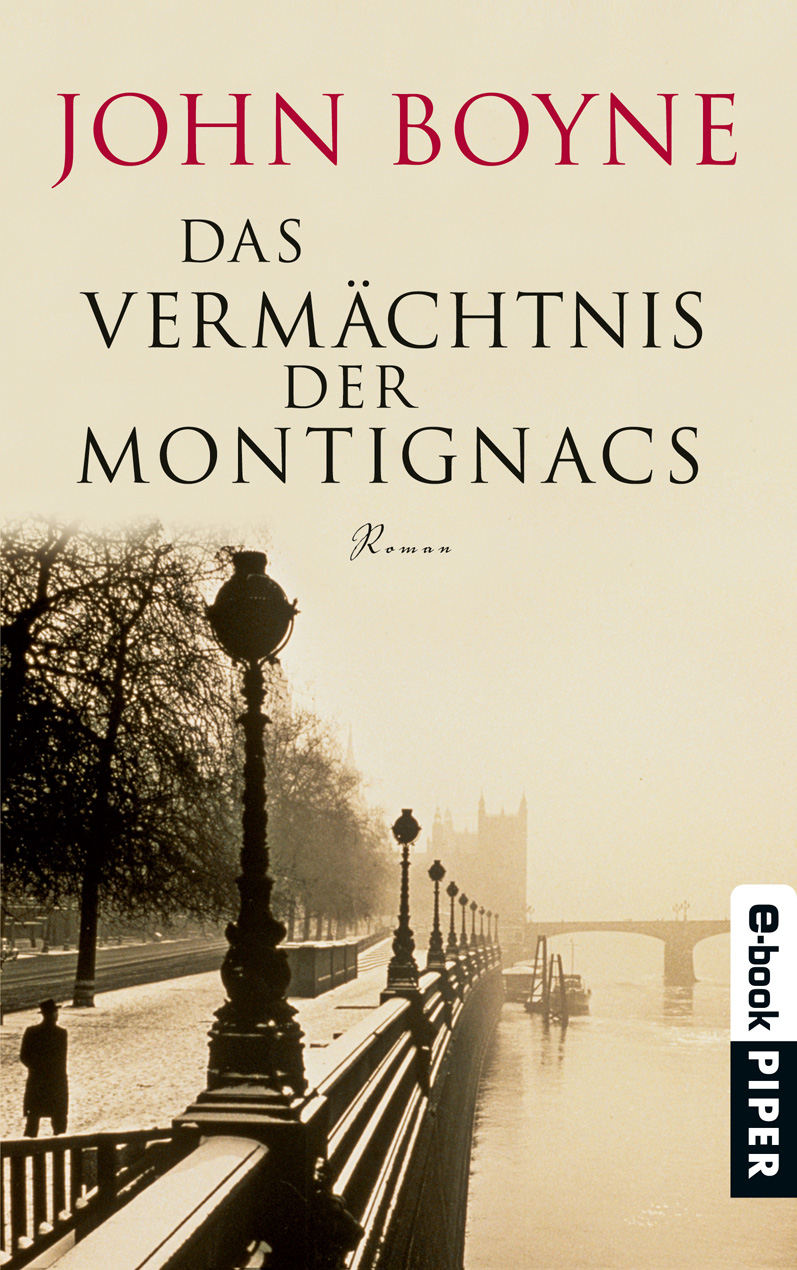![Das Vermächtnis der Montignacs]()
Das Vermächtnis der Montignacs
nichtssagenden Gemälde Laute der Bewunderung ausstieÃen und sich in tollkühnen Deutungen versuchten. Während der Ãffnungszeiten hielten sich in der Regel sowohl Montignac als auch Jason in der Galerie auf, doch unten in den Ausstellungsräumen reichte es meistens aus, wenn dort nur einer von ihnen anwesend war. Fragen der Sicherheit spielten keine Rolle, denn die Bilder hingen fest an der Wand, und die meisten Skulpturen waren zu schwer, um unauffällig entfernt zu werden. Folglich konnte Montignac in aller Ruhe oben bleiben, ohne prüfen zu müssen, was sich währenddessen unten abspielte.
Als Stella die Galerie betrat, stand er im Zwischengeschoss und untersuchte eine flackernde Leuchte über einem abstrakten Gemälde. Stella schaute sich nach ihm um, woraufhin er sich instinktiv zu einer Stelle zurückzog, die von unten nicht einsehbar war. Von dort aus beobachtete er, wie sie an den Bildern entlangwanderte, vor den neueren Werken kurz verharrte und sich dann in Richtung seines Schreibtischs wandte. Dort saà er gewöhnlich, blätterte in Kunstkatalogen oder löste das Kreuzworträtsel der Times , während Jason sich um die trivialeren Angelegenheiten kümmerte, wie den Kunden weiterzuhelfen oder die Leuchten instandzuhalten, was er jedoch nicht getan hatte.
Von unten ertönte die kleine Glocke, auf die Stella getippt hatte. Er trat an die Balustrade und schaute zu ihr hinab. Als sie zu sprechen begannen, überschnitten sich ihre Worte.
»Kundschaft«, rief sie.
Er rief: »Stella, ich bin hier oben.«
Sie legte den Kopf in den Nacken, sah zu ihm hoch und grinste. »Versteckst du dich etwa?«
Er lächelte ihr zu und schüttelte den Kopf. Sein Blick fiel auf die drei Einkaufstüten in ihren Händen, und er fragte sich, wie viel des ihm gestohlenen Geldes sie an diesem Morgen bereits ausgegeben hatte und wie viel davon, ehe der Tag zu Ende war, noch in den Ladenkassen der Oxford Street, der Regent Street und Covent Garden landen würde.
»Ich bin gleich unten«, rief er. »Leg schon mal ab.«
»Na schön, danke«, sagte sie.
Er sah zu, wie sie die Tüten hinter seinen Schreibtisch stellte, ihren Mantel abstreifte und über seinen Stuhl legte. Als er erkannte, wie leicht es ihr fiel, sich in seinen Geschäftsräumen wie zu Hause zu benehmen, fühlte er sich geschmeichelt und war gleichzeitig verärgert. Zu glauben, dass die Welt ausschlieÃlich ihrer Bequemlichkeit diente, gehörte zu ihren Eigenheiten.
In Gedanken kehrte er zu dem Tag zurück, als er ihr erstmals begegnet war. Damals war er fünf Jahre alt gewesen und gerade per Schiff von Calais nach Dover verfrachtet worden. In Dover hatte sein Onkel ihn in Empfang genommen und nach Leyville gefahren.
»Leyville wird ab jetzt dein Zuhause sein«, erklärte Peter Montignac auf der Fahrt. »Du wirst bei uns leben, bei meiner Frau, mir und unseren beiden Kindern. Freut dich das nicht?« Sein Onkel klang über die MaÃen selbstgefällig, als wäre er Gottvater, der einem hoffnungslosen Sünder in einem Akt der Barmherzigkeit den Eintritt ins Paradies gewährt hatte.
Montignac starrte den fremden Mann an und wagte es nicht, zu antworten.
»Was ist?«, fragte Peter. »Hast du deine Zunge verschluckt?«
In stockendem Englisch entgegnete er, dass er sich freue, hier zu sein. Mit seinen Eltern hatte er immer nur Französisch gesprochen und fühlte sich im Englischen unsicher. Zwar hatte sein Vater Henry ihm die Sprache beigebracht, aber wenn sie sich zu Hause unterhalten hatten, wurde sie nur selten benutzt. Die Vorstellung, künftig nur noch Englisch zu sprechen, machte ihn beklommen, denn er fürchtete, seine neu entdeckten Verwandten würden ihn, wenn sie ihn hörten, für unwissend und tölpelhaft halten.
»Gegen deinen Akzent müssen wir noch etwas unternehmen«, sagte Peter grimmig. »So kannst du bei uns nicht reden. Da bekommen die Leute im Dorf ja Angst vor dir.«
Seinerzeit war Andrew acht Jahre alt gewesen und Stella gerade sechs geworden. Am Tag von Montignacs Ankunft erklärte ihre Mutter ihnen, dass ihr Cousin künftig bei ihnen wohnen würde, ein Junge, der Vater und Mutter verloren und deshalb auÃer ihnen niemanden mehr habe, der für ihn sorgen könne, und dass sie ihn wie einen Bruder behandeln müssten.
»Warum haben wir von ihm noch nie gehört?«, fragte
Weitere Kostenlose Bücher