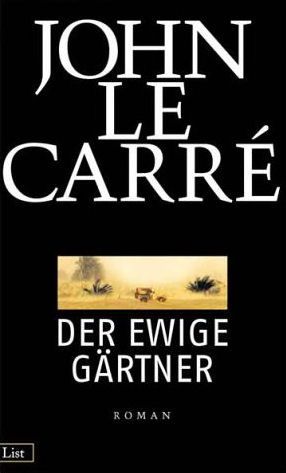![Der ewige Gaertner]()
Der ewige Gaertner
aufrecht hin, wie jemand, der beim Kartenspiel den Einsatz erhöht. Seine Hände sinken auf die Schenkel, als warteten sie dort auf weitere Befehle. Er gewinnt wieder die Macht über seine Stimme, die wie von einer inneren Kraft getrieben aus großer Tiefe an die Oberfläche drängt, in die unangenehm abgestandene Luft des Woodrowschen Esszimmers, in dem noch der Soßengeruch vom Abendessen des Vortags hängt.
»Sie war so impulsiv «, erklärt er stolz, und wieder zitiert er Vorträge, die er sich selbst Stunde um Stunde gehalten hat. »Das habe ich von Anfang an geliebt an ihr. Sie wollte unbedingt sofort ein Kind haben. Der Tod ihrer Eltern musste so schnell wie möglich kompensiert werden! Warum bis zur Hochzeit warten? Ich hielt sie zurück. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich berief mich auf die Konvention – weiß der Himmel, warum. ›Na schön‹, sagte sie, ›wenn wir verheiratet sein müssen, um ein Baby zu bekommen, dann lass uns auf der Stelle heiraten.‹ Also fuhren wir nach Italien und heirateten auf der Stelle, zum großen Vergnügen meiner Kollegen.« Justin ist jetzt selbst ein wenig amüsiert. » ›Quayle ist verrückt geworden! Der alte Justin hat seine Tochter geheiratet! Hat Tessa eigentlich schon ihr Abitur?‹ Als sie nach drei Jahren vergeblicher Anläufe schwanger wurde, hat sie geweint. Ich auch.«
Er hält inne, doch niemand unterbricht seinen Redefluss.
»Die Schwangerschaft veränderte sie. Aber nur zum Guten. Tessa wuchs hinein in ihre Rolle als Mutter. Äußerlich behielt sie ihr unbeschwertes Wesen. Aber in ihrem Innern erwachte ein tiefes Gefühl der Verantwortung. Ihr Engagement gewann für sie neue Bedeutung. Wie man mir sagte, ist das nichts Ungewöhnliches. Was vorher wichtig war, wurde jetzt zur Berufung, ja, praktisch zum Schicksal. Noch im siebten Monat kümmerte sie sich tagsüber um die Kranken und Sterbenden und kam abends zurück, um zur albernen Dinnerparty irgendeines Diplomaten in der Stadt zu gehen. Je näher der Geburtstermin rückte, desto entschlossener war sie, dem Baby eine bessere Welt zu bereiten. Nicht nur unserem Kind. Allen Kindern. Mittlerweile hatte sie ihr Herz an ein afrikanisches Krankenhaus gehängt. Wenn ich sie gezwungen hätte, in eine private Klinik zu gehen, hätte sie es getan, aber das wäre wie ein Verrat an ihr gewesen.«
»Inwiefern?«, murmelt Lesley.
»Tessa entschied ganz bewusst zwischen beobachtetem und geteiltem Leid. Beobachtetes Leid ist das Leid der Journalisten. Es ist das Leid der Diplomaten. Oder Fernsehleid, das vorbei ist, sobald man den blöden Kasten ausschaltet. Wer dem Leiden zusieht und nichts unternimmt, war für sie nicht viel besser als jene, die es verursachen. Sie nannte sie die schlechten Samariter.«
»Aber sie hat doch was dagegen unternommen«, wendet Lesley ein.
»Deswegen eben das afrikanische Krankenhaus. Manchmal steigerte sie sich da so hinein, dass sie ihr Kind sogar im Slum von Kibera zur Welt bringen wollte. Gott sei Dank ist es Arnold und Ghita gemeinsam gelungen, ihr die Unverhältnismäßigkeit einer solchen Aktion vor Augen zu führen. Arnold besitzt Autorität in Sachen Leid. Nicht nur, dass er Folteropfer in Algerien behandelt hat, er ist selbst gefoltert worden. Er hatte sich den Ausweis eines Verdammten dieser Erde wahrlich verdient. Ich hatte das nicht.«
Rob stürzt sich darauf, als wäre dieser Punkt nicht schon zur Genüge behandelt worden. »Es ist ein bisschen schwer zu begreifen, wo Sie da eigentlich ins Spiel kamen, oder? Ist man nicht ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen, wenn man so hoch oben in den Wolken schwebt? Sie, mit Ihrem Leid eines Diplomaten und Ihrer hohen Kommission?«
Aber Justins Nachsicht kennt keine Grenzen. Und manchmal ist er schlicht zu wohlerzogen, um zu widersprechen. »Sie hat mich vom aktiven Dienst befreit, wie sie es nannte«, bestätigt er mit vor Scham gesenkter Stimme. »Sie hat sich allerlei Scheinargumente ausgedacht, die es mir leicht machen sollten. Die Welt brauche uns beide, behauptete sie; mich, um das System von innen zu bewegen, und sie, um ihm von außen zuzusetzen. ›Ich bin diejenige, die an den moralischen Staat glaubt‹, sagte sie dann. ›Wenn ihr Typen eure Arbeit nicht machen würdet, welche Hoffnung hätten wir anderen dann noch?‹ Wir wussten beide, dass das nur Sophisterei war. Das System brauchte meine Arbeit nicht. Genauso wenig wie ich. Was für einen Sinn hatte sie denn auch? Ich schrieb Berichte, die niemand zur
Weitere Kostenlose Bücher