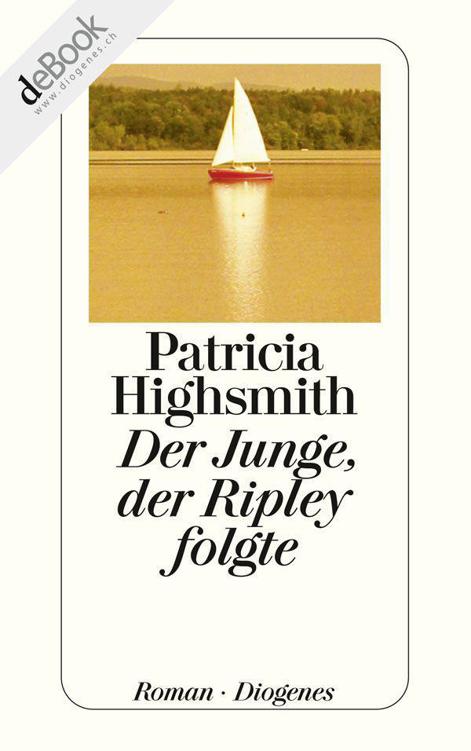![Der Junge, der Ripley folgte (German Edition)]()
Der Junge, der Ripley folgte (German Edition)
gemeint ist, Mexico-City oder New York.«
Tom kannte es. Eine von Bernard Tufts’ Fälschungen. »Jetzt weiß ich wieder«, sagte Tom, wie in liebevoller Erinnerung an ein echtes Bild. »Dein Vater mochte Derwatt?«
»Wer nicht? Seine Bilder haben etwas Warmes – etwas Menschliches, besser gesagt –, das man in der modernen Malerei nicht immer findet. Ich meine, wenn man Wärme will. Francis Bacon ist hart und realistisch, doch das Bild dort ist das auch, selbst wenn es nur zwei kleine Mädchen zeigt.« Der Junge warf einen Blick über die Schulter auf die beiden kleinen Mädchen auf den roten Stühlen vor einem flammend roten Feuer – ein Gemälde, das man schon wegen des Sujets warm nennen konnte, aber Tom wußte, daß Frank mit Wärme Derwatts innere Einstellung meinte, die sich immer wieder in seinen Konturen von Körpern und Gesichtern zeigte.
Seltsamerweise war Tom persönlich gekränkt, weil der Junge offensichtlich nicht dem Mann im Sessel den Vorzug gab – einem Bild, das die gleiche Wärme des Malers ausstrahlte, auch wenn weder Mann noch Sessel in Flammen stand. Das Werk war aber nicht echt. Deshalb gefiel es Tom auch besser. Wenigstens hatte Frank noch nicht gefragt, ob es gefälscht sein könnte, denn falls er das täte, mußte er etwas gehört oder gelesen haben. »Ich sehe, Gemälde gefallen dir.«
Der Junge wand sich ein wenig. »Rembrandt mag ich sehr. Vielleicht finden Sie das seltsam. Mein Vater besitzt einen. Er zeigt ihn nicht, hat ihn irgendwo in einem Safe liegen. Aber ich habe das Bild ein paarmal gesehen. Nicht sehr groß.« Frank räusperte sich, setzte sich auf. »Allerdings zum Vergnügen…«
Darum ging es doch bei der Malerei, dachte Tom, ganz gleich, ob Picasso meinte, Bilder malen heiße Krieg zu führen.
»Ich mag Vuillard und Bonnard. Die sind soanheimelnd. Dieses moderne Zeug, die Abstrakten… Eines Tages werd ich sie vielleicht verstehen.«
»Dann hattest du mindestens eines mit deinem Vater gemein: Ihr mochtet beide Bilder. – Hat er dich zu Ausstellungen mitgenommen?«
»Na ja, ich bin allein hingegangen. Gern sogar, wirklich. Seit ich zwölf Jahre alt war, das weiß ich noch. Aber mein Vater saß im Rollstuhl, seit ich etwa fünf war. Jemand hat auf ihn geschossen, wissen Sie?«
Tom nickte. Auf einmal wurde ihm klar, daß Franks Mutter wegen John Piersons Zustand in den letzten elf Jahren ein seltsames Leben geführt haben mußte.
»Aus geschäftlichen Gründen. Nett, nicht?« fuhr Frank zynisch fort. »Mein Vater wußte, wer dahinterstand: ein anderer Lebensmittelkonzern. Ein bezahlter Killer. Aber mein Vater hat die Leute nie verfolgt – gerichtlich, meine ich –, weil er wußte, sonst würden sie noch einen schicken. Verstehen Sie, so ist das nun mal in den Staaten.«
Tom glaubte es gern. »Probier deinen Cognac.« Der Junge nahm das Glas, nippte und verzog das Gesicht. »Wo ist deine Mutter jetzt?«
»In Maine, denke ich. Oder in der New Yorker Stadtwohnung. Keine Ahnung.«
Tom blieb bei dem Thema, weil er hoffte, Frank werde etwas Neues sagen: »Ruf sie an, Frank. Die beiden Nummern hast du sicher im Kopf. Da ist das Telefon.« Es stand auf einem Tisch neben der Haustür. »Ich gehe nach oben, dann kann ich nicht hören, was du sagst.« Er stand auf.
»Ich will nicht, daß sie herausfinden, wo ich bin.« Der Blick des Jungen war jetzt fester. »Ich würde ein Mädchen anrufen, wenn ich könnte, doch nicht mal sie soll wissen, wo ich bin.«
»Wie heißt sie?«
»Teresa.«
»Und wohnt in New York?«
»Ja.«
»Dann ruf doch sie an! Macht sie sich nicht Sorgen? Du brauchst ihr nicht zu sagen, wo du bist. Ich gehe trotzdem nach oben…«
Aber Frank schüttelte langsam den Kopf. »Sie könnte merken, daß der Anruf aus Frankreich kommt. Das kann ich nicht riskieren.«
War er wegen des Mädchens weggelaufen? »Hast du Teresa erzählt, daß du weg wolltest?«
»Ich hab ihr erzählt, ich wollte kurz verreisen.«
»Hattet ihr Streit?«
»Ach nein, das nicht.« Stille Freude lag auf seinem Gesicht, ein verträumter Ausdruck, den Tom an dem Jungen noch nicht kannte. Dann sah er auf seine Uhr und stand auf. »Tut mir leid.«
Erst kurz vor elf. Aber Frank wollte nicht, daß Héloïse ihn wiedersah, das wußte Tom. »Hast du ein Foto von Teresa?«
»O ja!« Wieder strahlte er vor Freude. Aus der Innentasche des Jacketts zog er seine Brieftasche hervor. »Das hier. Mein Lieblingsfoto, auch wenn’s nur Polaroid ist.« Er reichte Tom einen kleinen,
Weitere Kostenlose Bücher