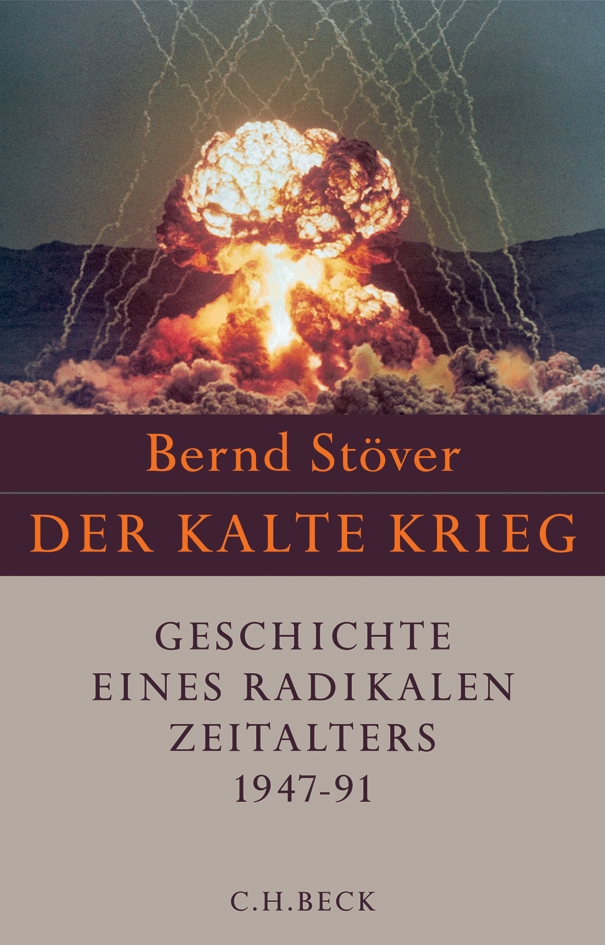![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
untergeordnete Rolle, was in den Brennpunkten des Kalten Krieges mit den eingeschränkten Programmen und Reichweiten, aber auch den fehlenden Empfangsgeräten zu tun hatte. In den USA, wo 1946 ein regelmäßiges Fernsehprogramm gestartet worden war, hatten Mitte der fünfziger Jahre immerhin ein Drittel der Haushalte ein Fernsehgerät. In der Sowjetunion und im Ostblock lag man weit dahinter, obwohl auch in Moskau mit Hilfe der USA schon seit 1938 ein Fernsehprogramm eingerichtet worden war. Zwar waren bereits in den fünfziger Jahren auch sowjetische Auslandsfernsehprogramme installiert, 36 und auch ein «Volksfernseher» wurde seit 1948 produziert. Doch noch in den sechziger Jahren lag die Zahl der Fernsehempfänger in der UdSSR bei nur zwanzig Millionen. Auch im geteilten Deutschland, wo beide Seiten zwischen 1952 und 1956 mit der Popularisierung des Fernsehens begannen, lag der Westteil in Führung. In der Bundesrepublik waren 1960 rund vier Millionen Teilnehmer registriert, in der DDR nur rund 700 000. 37
Die Wirkung der Rundfünk- und Fernsehsendungen hing natürlich neben den Empfangsbedingungen, die 1967 durch die unterschiedlichen Farbfernsehnormen (PAL/SECAM) noch einmal zusätzlich eingeschränkt wurden, maßgeblich von ihrer Attraktivität ab. Nimmt man auch hier wieder das deutsch-deutsche Beispiel zum Ausgangspunkt, so zeigt sich, daß eine grundsätzliche Sorge über den gegnerischen Einfluß durchaus auf beiden Seiten vorhanden war. Das Interesse der Bundesbürger an DDR-Programmen war allerdings immer überschaubar, obwohl vor allem in den ersten Jahrzehnten des Kalten Krieges im Westen immer wieder über die «Übermacht des Zonenrundfunks» lamentiert wurde. 38 Dies konnte man sogar am Beispiel des Fernsehens beobachten. Seit Anfang der fünfziger Jahre war zwar über die Hälfte der Bundesbürger zumindest technisch in der Lage, DDR-Sendungen zu empfangen, in der Praxis geschah dies allerdings nur in Ausnahmefällen. Zwar wurden alte Spielfilme gerne gesehen, aber ansonsten diskreditierte sich das DDR-Fernsehen in den Augen der Bundesbürger durch zu eindeutige Ideologisierung, politische Überfrachtung und antiquierte Präsentation der Programme. Dies sahen selbst DDR-Bürger kaum anders. Insbesondere der zweite Kanal des DDR-Fernsehens hatte mit dem Negativimage des «Russenprogramms» zu kämpfen. 39 1979 gaben anläßlich einer Umfrage 56 Prozent der DDR-Bürger an, sie würden regelmäßig Westprogramme einschalten. Bis
1987 stieg diese Zahl auf rund 85 Prozent. 40
Daß dies etwas mit einer langfristigen Entscheidung für den Westen zu tun hatte, läßt sich insbesondere an den einschlägigen DDR-Politikformaten zeigen, die, wie Eduard von Schnitzlers Schwarzer Kanal, bereits in der Frühzeit des Kalten Krieges entstanden waren und nahezu unverändert bis zum Ende des Konflikts beibehalten wurden. Schnitzler, der sich selbst als «Frontsoldat» des Kalten Krieges begriff, kam in der DDR bis zur Abschaltung des Programms am 30. Oktober 1989 im Durchschnitt auf 14 Prozent Sehbeteiligung und wurde schon lange vor seiner letzten Sendung zur Zielscheibe böser Witze. 41 Daß die Ablehnung Schnitzlers aber keineswegs allein an der politischen Überfrachtung und Antiquiertheit der Präsentation lag, zeigte sich im Kontrast zum westlichen Pendant. Gerhard Löwenthals ZDF-Magazin, das seit 1969 wöchentlich in ähnlicher Weise an vorderster Front des Kalten Krieges kämpfte, kam in der DDR bis zum Ende des Formats 1987 auf durchschnittlich 40 Prozent Zuschaueranteil.
Die Möglichkeiten, die auch die DDR im Kampf der Medien hatte, wurden eher schlaglichtartig deutlich. Bezeichnenderweise wurden solche Highlights dann aber jeweils schnell verboten oder rasch auf die offizielle Parteilinie gebracht. DDR-Pro-gramme, die weniger penetrant auf die offiziell verordneten politischen Themen, sondern eher auf eine Mischung aus frech präsentierter Politik und dann auch westlicher Musik setzten, waren in den fünfziger und sechziger Jahren zeitweilig sogar in Westdeutschland auf gute Resonanz gestoßen. Das hatte sich erstmalig im Zusammenhang mit dem zwischen 1956 und 1971 tätigen Deutschen Freiheitssender 904 gezeigt. Die von der Führung der NVA eingerichtete und in der Nähe von Magdeburg aufgebaute Station gewann tatsächlich bei Angehörigen der westdeutschen Bundeswehr Popularität. 42 Noch erfolgreicher wurde das 1964 gegründete DDR-Jugendradio DT 64. Der Sender spielte «heiße Tanzmusik», die
Weitere Kostenlose Bücher