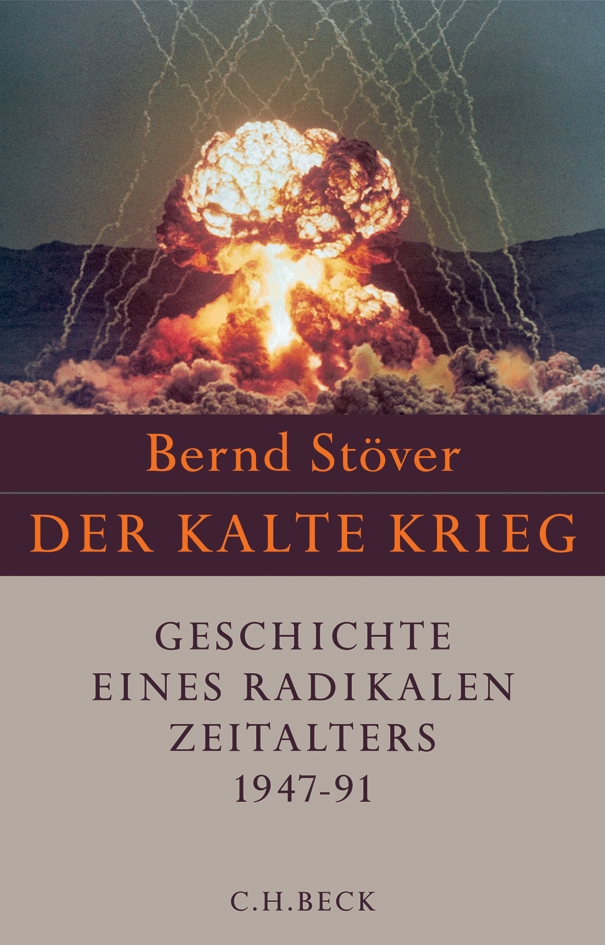![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
eingefordert, die Entflechtung der Großkonzerne, die Beteiligung der Arbeitnehmer an der Führung der Betriebe, die Stärkung der Betriebsräte, die Verstaatlichung der Montanindustrie und der Ausbau des Genossenschaftswesens. Auch auf die Notwendigkeit einer Bodenreform wurde verwiesen. Ohne Zweifel meinte man solche Forderungen ehrlich, denn das Programm wurde 1948 unter dem Titel Was will die CDU? veröffentlicht.
Der widersprüchliche Inhalt des Ahlener Programms ist nur dann richtig einzuordnen, wenn man berücksichtigt, daß sich die 1945 neu entstandene CDU aus einem relativ heterogenen Kreis zusammensetzte und sozialistische Ideen nicht unbedingt auf den Marxismus zurückgeführt sein mußten. In diesem Fall ging der «Christliche Sozialismus» - den Begriff strich man später aus dem Programm - auf den zeitweilig hohen Einfluß christlicher Gewerkschafter und Dominikaner in der Partei zurück. Christlicher Sozialismus galt hier als Teil der Abwehr des Kommunismus. In diesem Umfeld entstanden im Juni 1945 auch die «Kölner Leitsätze» der Christdemokraten, die ebenfalls stark von der katholischen Soziallehre beeinflußt waren. Auch sie beinhalteten die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und Güterausgleich. Das Ahlener Programm der CDU verschwand allerdings dann ebenso rasch aus der realen Politik wie andere Versuche in den Westzonen Deutschlands, aus der Erfahrung des Nationalsozialismus und der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs einen Neuanfang mit einer grundsätzlichen Um- und Neuverteilung der Besitzverhältnisse abzuleiten. Als wichtigste politische Kraft gegen den Christlichen Sozialismus galt der CDU-Vorsitzende Konrad Adenauer selbst, der bereits im Sommer 1946 warnte, man gewinne zwar mit dem Wort Sozialismus fünf Leute, dafür würden aber zwanzig weglaufen. 13
Die Westalliierten blieben in dieser Frage zunächst ebenso gespalten. Vor allem die Briten entwickelten in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als die Labour Party mit Deutschlandminister John Hynd die Politik bestimmte, teilweise lebhaftes Interesse an Verstaatlichungen, während sich die US-Regierung aus verschiedenen Gründen strikt ablehnend verhielt. Die Motive lagen vor allem in einer unterschiedlichen Einschätzung des sicherheitspolitischen Nutzens im Kalten Krieg. Sozialistische Ideen hielten die Amerikaner für ein Einfallstor des Kommunismus, aber auch für ökonomisch kontraproduktiv. Die Briten wiederum verstanden sie zunächst als eine der Möglichkeiten, um ein Wiederaufleben des Nationalismus in Deutschland zu verhindern. In der westdeutschen Bevölkerung herrschte dagegen eher Desinteresse. 14 Fragen des schlichten Überlebens waren im Nachkriegsdeutschland wichtiger. Zudem wirkte gerade in solchen Fragen der Kalte Krieg, der schnell «linke» Vorschläge verdächtig machte. Tatsächlich konnte man unter Hinweis auf die mit drastischen Mitteln durchgesetzte Bodenreform und Verstaatlichung in der SBZ sozialistische Ideen in den Westzonen relativ rasch vom Tisch wischen.
Das in den Westzonen und dann in der Bundesrepublik gültige Konzept der Sozialen Marktwirtschaft war dann eine Art Kompromiß geworden. Im Grundgesetz wurde in Artikel 20 die «Sozialstaatsklausel» verankert: «Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat.» 15 Sie war nicht nur die Absage an einen totalen Wohlfahrtsstaat, sondern gleichzeitig das Bekenntnis zu einer Ordnung, die auf den sozialen Ausgleich setzte. Zusammen mit den Grundrechtsbestimmungen ergaben sich aus Artikel 20 unter anderem ein Fürsorgeanspruch bei Bedürftigkeit und eine Zwangsversicherung, die zum Beispiel zur Altersvorsorge dienen und bei Krankheit eingreifen sollte. Das war kollektive Daseinsvorsorge, die allerdings gleichzeitig die Verantwortung des Einzelnen erhalten sollte. Auf einen Katalog spezifischer sozialer Grundrechte - so zum Beispiel das Recht auf Arbeit -, wie sie in der DDR-Verfassung verankert wurden, verzichtete das Grundgesetz, wenngleich über solche Fragen auch im Westen ausführlich diskutiert wurde.
Zwischen den beiden deutschen Staaten war die unterschiedliche Interpretation der Sozialstaatsidee ein Teil der auf beiden Seiten seit 1946 verfochtenen «Magnettheorie» - der regionalen Variante des globalen Systemwettbewerbs. «Insbesondere im Kalten Kriege entscheiden die Bataillone der besseren Sozialleistungen» hieß so ein Kernsatz, den man auf beiden Seiten Deutschlands unterschreiben konnte. 16 Die
Weitere Kostenlose Bücher