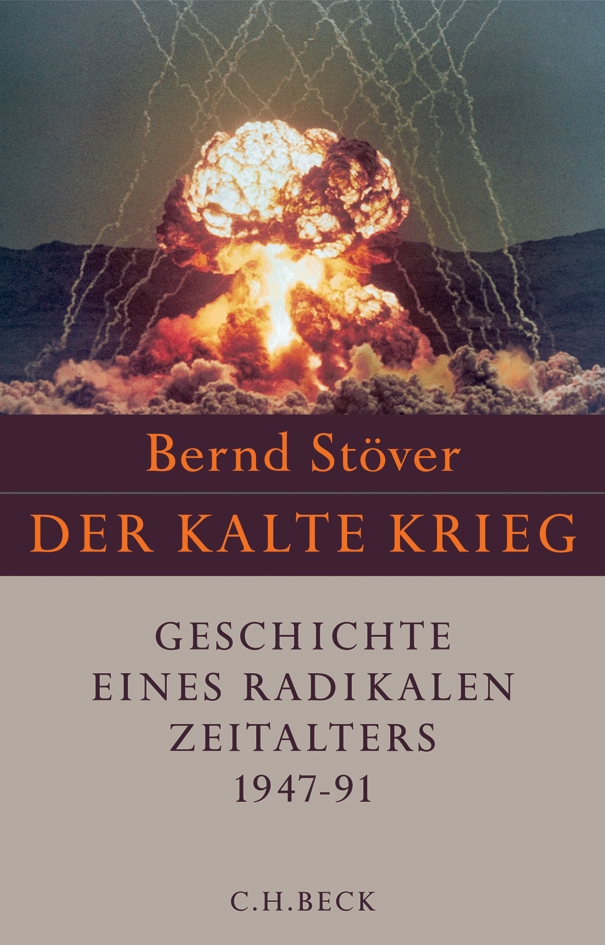![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
sozialstaatliche Angebotspalette der DDR war beeindruckend und übertraf in ihrem Versprechen nach totaler Fürsorge den Anspruch des bundesrepublikanischen Sozialstaats um Längen. Bereits in den Jahren vor der Staatsgründung festgelegt und dann in der DDR-Verfassung 1949 verankert, waren die Inhalte immer wieder erweitert, einzelne politisch unerwünscht gewordene Ansprüche aber wieder gestrichen worden. Dabei spielten in Ostdeutschland neben dem andauernden Konkurrenzverhältnis zur Bundesrepublik vor allem die Sorgen vor politischer Destabilisierung eine entscheidende Rolle. Den Höhepunkt bildete der unter Honecker 1976 während des IX. Parteitags der SED verabschiedete «Grundsatz der Einheit von Wirtschaftsund Sozialpolitik». Er konnte freilich nur dann fünktionieren, wenn das planwirtschaftliche System der DDR dauerhaft so effektiv arbeitete wie erhofft. Dies hatte es allerdings auch vor 1976 niemals getan. Daß die SED unter Honecker ausgerechnet jetzt diesen Grundsatz verordnete, hatte wiederum etwas mit der Konkurrenz mit dem Westen zu tun. In der ersten Ölkrise 1973/74 und den ihr folgenden Wirtschaftsproblemen war in den westlichen Staaten mit ausgebautem Sozialsystem massiv der Wohlfahrtsstaat unter Beschuß geraten. Vor diesem Hintergrund machte die DDR einen weiteren Schritt in dem Versuch, sich als «der bessere deutsche
Staat» und als Alternative zur Bundesrepublik zu profilieren. Wie unumkehrbar diese aus politischen Gründen getroffene Entscheidung war, macht eine von Honeckers Stellvertreter Egon Krenz überlieferte Äußerung im Mai 1989 - ein halbes Jahr vor dem Fall der Mauer - deutlich. Nachdem die Staatliche Plankommission für 1991 den finanziellen Bankrott der DDR vorausgesagt hatte, falls man nicht den mittlerweile unfinanzierbaren Beschluß von 1976 rückgängig mache, hatte Krenz, der im Oktober 1989 dann auch Honecker als Generalsekretär der SED ersetzte, ausgeführt, für ihn sei das Ende der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik keine Alternative. «Sie muß fortgeführt werden, denn sie ist ja der Sozialismus in der DDR!» 17
Die DDR-Verfassungen durchliefen im Gegensatz zum bundesrepublikanischen Grundgesetz mehrere Entwicklungsstufen, an deren Ende dann 1968/1974 eine «sozialistische Verfassung» stand. Auch wenn viele der verbrieften Rechte nur auf dem Papier bestanden, war der Verfassungskatalog des akribisch und schließlich bis in den letzten Winkel durchherrschten «Fürsorgestaats» DDR für Außenstehende beeindruckend. Zur ersten Verfassung gehörten neben der Gewährung von persönlichen und kollektiven, «bürgerlichen» Grundrechten - etwa Gleichberechtigung, persönliche Freiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung, Postgeheimnis, Versammlungs- und Meinungsfreiheit - auch eine Reihe von einschlägigen sozialpolitischen Rechten. Bevor die 1968 und 1974 umgeschriebene «sozialistische Verfassung» dann wieder wesentliche Grundrechte strich, waren hier ein Widerstandsrecht, das sogar zu einer Widerstandspflicht ausgeweitet worden war, ein Zensurverbot, die Wirtschaftsfreiheit, das Auswanderungsrecht und nicht zuletzt auch das Streikrecht verankert. Die DDR-Verfassungen kannten darüber hinaus, im Gegensatz zum bundesdeutschen Grundgesetz, ein «Recht auf Arbeit» und ein «Recht auf Wohnraum» - Zugeständnisse, die man im Grundgesetz der Bundesrepublik vergeblich suchte. 18 In der DDR waren auch diese allerdings niemals wortwörtlich zu nehmen gewesen, sondern zunächst durch die vom Verfassungstext abweichende Praxis der Rechtsprechung, dann durch explizite Zusätze eingeschränkt. Das in der Verfassung verankerte «Recht auf Arbeit» beinhaltete in der Praxis daher nicht nur die Pflicht zu «gesellschaftlich nützlicher Arbeit», sondern wurde zusätzlich von den «gesellschaftliehen Erfordernissen» abhängig gemacht. Ähnliche Einschränkungen gab es auch etwa in bezug auf das Wohnungsrecht.
Auch wenn die Praxis dieser Verfassungsrechte immer ganz anders aussah, zeigt der Vergleich der Wanderungsbewegungen zwischen beiden deutschen Staaten deutlich, daß insbesondere die zuletzt genannten sozialpolitischen Rechte eine Reihe von Bundesbürgern dazu bewog, in die DDR zu ziehen. Wohin die innerdeutschen Migrationsströme in der Hauptsache gingen, war allerdings nicht zu übersehen. Die Zahl der Flüchtlinge aus der SBZ betrug bereits vor der Gründung der DDR 1949 rund 730 000 Menschen und erhöhte sich bis zum Mauerbau am 13. August 1961 noch einmal um rund
Weitere Kostenlose Bücher