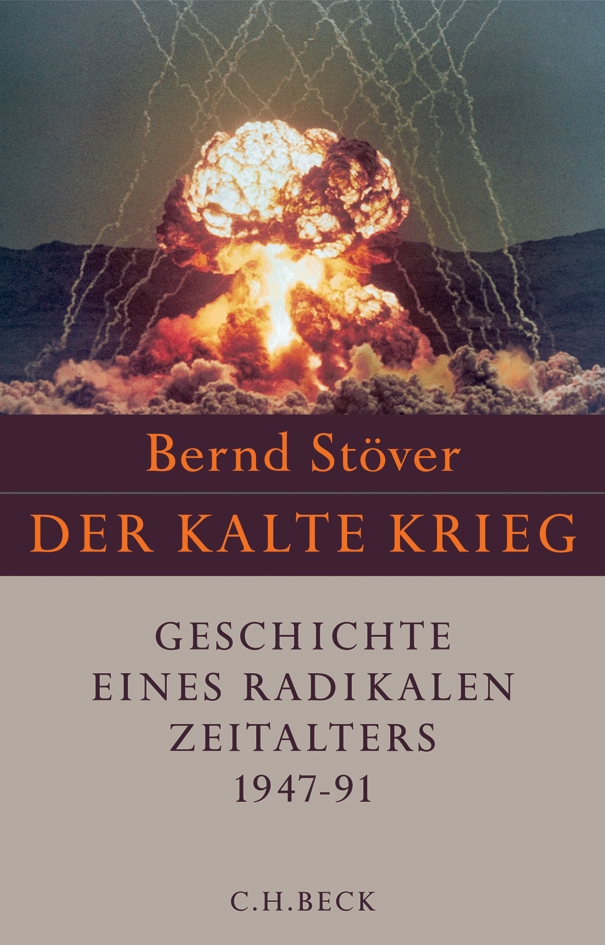![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
Ende verteidigten sozialpolitischen Errungenschaften blieben so - wie vieles andere im Wettbewerb mit dem Westen - durch Verschuldung erkauft. Mit dem ökonomisch-politischen Zusammenbruch des Kommunismus am Ende des Kalten Krieges verschwanden daher auch seine umfassenden sozialen Systeme. Dennoch: Auch wenn im Rückblick betrachtet die Sozialpolitik in der Systemkonkurrenz eher nur zeitweilig und partiell, teilweise auch nur virtuell etwas mit dem Wettbewerb der Blöcke zu tun hatte, belegte die Zeit nach dem Kalten Krieg eines doch deutlich. Das Ende des globalen Konflikts 1991 und der Untergang des Kommunismus verringerten nachweislich die Bemühungen im Westen, die eigenen Sozialstaatsmodelle auf dem hohen Niveau des Kalten Krieges zu halten. Dieser Trend läßt sich auch auf anderen Gebieten, etwa in der Entwicklungshilfe, nachweisen.
Entwicklungshilfe als Waffe
Entwicklungshilfe im Kalten Krieg war einerseits humanitäre Hilfe an die ärmeren Staaten. Andererseits war sie in der Form, wie sie vergeben wurde, ebenfalls ein Teil des globalen Systemkonflikts, in dem die Supermächte und ihre Blöcke gegeneinander kämpften, um einen politischen, wirtschaftlichen oder militä-risch-geostrategischen Vorteil gegenüber der anderen Seite zu erringen. Anders als auf vielen anderen Gebieten des Konflikts waren hier aber auch die anderen Akteure aktiv vertreten: die dritte Großmacht China, die Blockfreien, die UNO und eine Reihe weiterer Organisationen, so die in der OPEC versammelten reichen Ölstaaten. Die Entwicklungshilfe war darüber hinaus ein Bereich, in dem sich insbesondere die Nichtregierungsorganisationen engagierten. Insbesondere China, das selbst als Entwicklungsland galt, zeigte, daß es neben der Nord-Süd-Hilfe aus den reichen Industrieländern immer auch eine Süd-Süd-Komponente der Entwicklungshilfe mit politischem Hintergrund gab. Ehemalige Empfänger konnten selbst zu Geberstaaten aufsteigen und dies ihrerseits mit politischen Interessen verknüpfen. Israel, die Türkei, Thailand, Taiwan, Südkorea, Malaysia, Indien oder Kuba wuchsen dadurch zu regionalen Größen. Teuere Prestigeobjekte gehörten dann auch für diese Gruppe ebenso dazu wie eine gezielte technisch-militärische Zusammenarbeit. Darüber hinaus wurden hier die Grundlagen für die Entwicklung von neuen regionalen Mächten nach dem Kalten Krieg gelegt.
Beschränkt man sich auf die beiden Supermächte des Kalten Krieges, kann man verkürzt zusammenfassen, daß beide die Unterstützungen, die sich in der Regel unübersichtlich in die eigentliche öffentliche, von staatlichen Stellen aufgebrachte Entwicklungshilfe (ODA) und verschiedene verdeckte Formen von Wirtschafts- und Militärhilfe unterteilten, als politisches Instrument im Kalten Krieg begriffen. Ihre Gewährung hatte immer auch den Charakter von Belohnung für politisches Wohlverhalten, ihre Entziehung den von politischer Bestrafung. Sowohl die Truman-Doktrin, und hier insbesondere der berühmte «Vierte Punkt» (Point Four), der 1949 auch zum Titel des ersten amerikanischen Entwicklungshilfeprogramms wurde, als auch Schdanows Zwei-Lager-Theorie hatten 1947 diese politische Zielrichtung deutlich gemacht. Entsprechend großzügig wurde von beiden Seiten jeweils in jenen Teilen der Welt investiert, in denen die politische Situation noch offen erschien. Diese Instrumentalisierung war nicht zuletzt am besonders ausgeprägten deutsch-deutschen Sonderkonflikt in der Dritten Welt zu beobachten, der zuweilen kuriose Züge annahm, weil selbst um die diplomatische Vertretung in unbedeutenden Staaten erbittert gerungen wurde. Für solche Länder, die zum Teil auch der Blockfreienbewegung angehörten, hatte dies auf der einen Seite zeitweilig sehr positive Auswirkungen. Dies zeigte sich etwa in Ägypten, das schließlich vom Westen und vom Ostblock profitierte. Auf der anderen Seite führte diese Praxis dazu, daß in besonders begehrten Regionen - so etwa in Angola - Auseinandersetzungen über Jahrzehnte anhielten. Selbst ldeinere Stammeskonflikte, die wahrscheinlich ohne die strategischen Blockinteressen bald wieder eingeschlafen wären - zu nennen ist hier etwa der Krieg zwischen Somalia und Äthiopien um die ostafrikanische Wüstenregion Ogaden zwischen 1977 und 1991 -, blieben so lange Zeit am Leben. Sogar rivalisierende lokale Clanchefs oder kriminelle Drogenbarone konnten mit ziemlicher Sicherheit zu irgendeinem Zeitpunkt während des Kalten Krieges mit Zuwendungen rechnen, wenn sie
Weitere Kostenlose Bücher