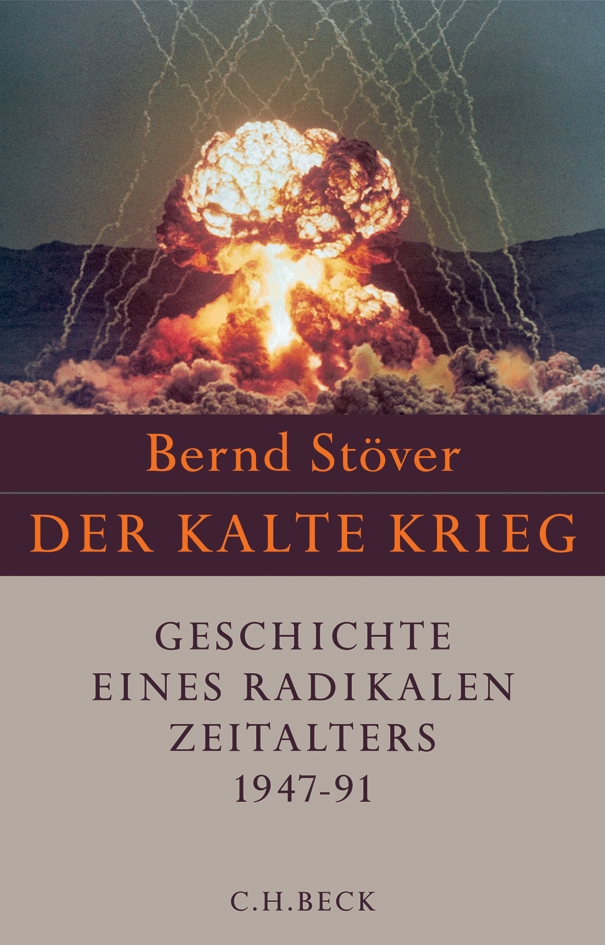![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
politisch bestä-tigt. Becher jedenfalls konnte in seinen Memoiren nur Positives über Reagan berichten, den er vor allem wegen seiner Haltung als antikommunistischer Hardliner und Gegner der Neuen Ostpolitik als eigentlichen Schöpfer der Vereinigung Deutschlands 1990 betrachtete. Diese sei nicht durch die «weichen Touren Kennedys und Nixons» entstanden, sondern erst mit der «Revitalisierung Amerikas durch Ronald Reagan». Er habe den Abbau der Mauer nicht nur gefordert, sondern politisch erzwungen. 16
Die konservative US-Administration um Nixon und Kissinger bewegte sich allerdings bereits 1970 deutlich in Richtung der Brandtschen Ostpolitik. Was sie störte, war etwas ganz anderes: Die sozialliberale Koalition in Bonn ging fast ohne Rücksprache mit Washington in die Verhandlungen mit dem Ostblock. Dies wurde angesichts der Konstellationen des Konflikts nach wie vor als Ausscheren aus der gemeinsamen Front wahrgenommen. «Offensichtlich war Bahr kein überzeugter Anhänger der westlichen Gemeinschaft wie die Politiker, die wir aus den früheren deutschen Regierungen kannten», vermerkte Kissinger noch in seinen Memoiren verärgert, «er war auch frei von allen gefühlsmäßigen Bindungen an die Vereinigten Staaten. Für ihn war Amerika nur ein Gewicht, das auf die richtige Art und zur rechten Zeit zugunsten der Bundesrepublik auf die Waagschale gelegt werden mußte.» 17
Gegen harte konservative Widerstände wurden bis 1973 die vier Verträge zwischen der Bundesrepublik auf der einen und der Sowjetunion sowie drei ihrer Verbündeten auf der anderen Seite geschlossen: der Gewaltverzichtsvertrag mit der UdSSR (12.8.1970), die Grundlagenverträge mit Polen (7.12.1970) und der DDR (21.12.1972) sowie der Vertrag über die Beziehungen mit der Tschechoslowakei (11.12.1973). Zur Durchsetzung der Ratifizierung im Bundestag wandte die sozialliberale Koalition angesichts der innenpolitischen Widerstände einen Trick an: Man koppelte das 1971 geschlossene Vier-Mächte-Ablcommen für Berlin, das mehrheitlich auch von den Konservativen gewünscht war, mit den Brandtschen Ostverträgen, womit es der Opposition unmöglich wurde, das Gesamtpaket abzulehnen. Trotzdem ging der Bruch - wie bereits in der Auseinandersetzung um die Verträge zur Westintegration in den fünfziger Jahren - quer durch die Parteifronten. Aus der Regierungskoalition schieden allein zehn Abgeordnete aus. Mit ihnen kippte dann auch die sozialliberale Mehrheit im Bundestag. Gleichzeitig gab es Gegner, die verdeckt die Verträge torpedierten. Man hat in den ersten anderthalb Jahren der sozialliberalen Koalition allein 54 Fälle von Geheimnisverrat gezählt, die wahrscheinlich aus der Zusammenarbeit von SED-«Westarbeit» und westlichem Nachrichtendienst resultierten. Mutmaßlich waren sogar der amerikanische Geheimdienst CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst beteiligt, als Geheimpapiere der Regierung gezielt der konservativen Presse zugespielt wurden. Allerdings waren selbst die Christdemokraten nicht geschlossen in ihrer Ablehnung. I )as Mißtrauensvotum gegen Brandt scheiterte, weil sich zwei CDU-Abgeordnete nicht an die Fraktionsdisziplin hielten. Man weiß mittlerweile auch in diesem Fall, welche Rolle die DDR-«Westar-beit» dabei spielte. Das MfS bestach damals den CDU-Abgeordneten Julius Steiner und konnte damit in der bundesdeutschen Innenpolitik einmal mehr - jedoch wieder nur punktuell - mitmischen. I )as Ende der Widerstände war damit noch nicht erreicht. Gegen den Grundlagenvertrag erhob die Bayerische Staatsregierung Verfassungsklage. Als die Verträge schließlich durchgesetzt und best atigt waren, galten sie bis zu ihrer Ablösung durch den Zwei-Plus-Vier-Vertrag am 12. September 1990. Danach wurden sie durch ein ganzes Bündel von Nachbarschaftsverträgen ersetzt.
Die Erfolge der Ostverträge konnten sich durchaus sehen lassen, wenngleich auch die Neue Ostpolitik - anders als manche Zeitgenossen damals wieder annahmen - noch nicht das Ende des Kalten Krieges bedeutete. Eine «gesamte, in sich geschlossene historische Phase», 18 wie man damals in der Publizistik erneut meinte, war der Kalte Krieg immer noch nicht. Aber die in Moskau, Warschau und Prag geschlossenen Verträge, in dem sich beide Seiten jeweils zum Gewaltverzicht und zur Grenzachtung verpflichteten, ei öffneten nach Kriegsende zum ersten Mal eine vertragliche Basis, die eine allm ähliche Normalisierung des Ost-West-Verhältnis-ses zumindest zuließ. Der
Weitere Kostenlose Bücher