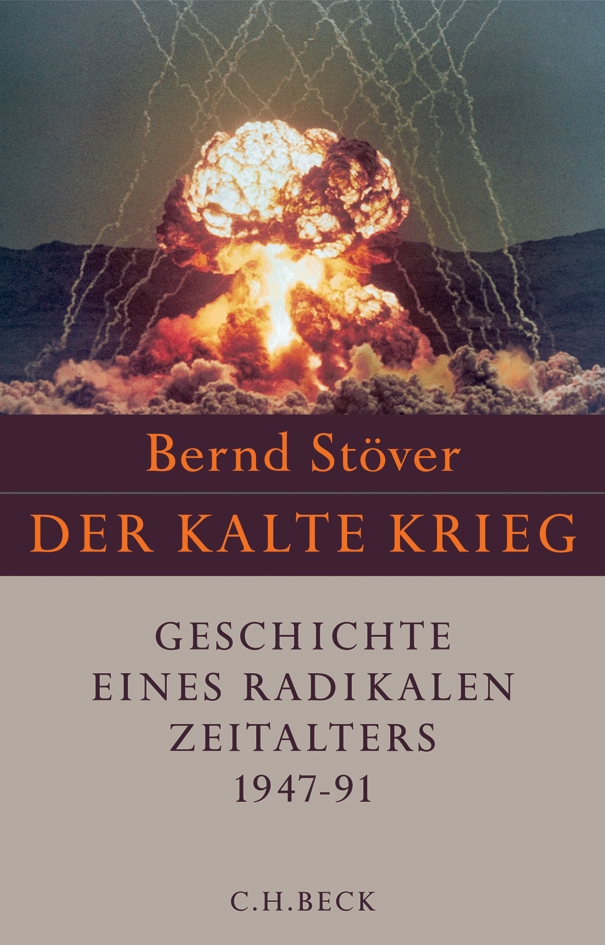![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
wenig. Zu nah schien der große, dann auch nuklear geführte Konflikt. Welche Gratwanderung dies etwa für die Radiostationen bedeutete, die seit Jahren auf eine Offensive gegen den Kommunismus eingeschworen waren, konnte man am Beispiel des Westberliner Senders RIAS verfolgen. Über ihn wurden unter anderem die Treffpunkte der Aufständischen weitergegeben. Ohne den RIAS, so vermerkte später der damals als Chefkommentator amtierende Egon Bahr, «hätte es den Aufstand so nicht gegeben». 10 Direkter in den Aufstand involviert waren einige der privaten Befreiungsorganisationen, die unter anderem Flugblätter druckten und an die Demonstranten verteilten. Erst nach dem Aufstand kam es zur großangelegten westlichen Hilfe. Sie hatte, wie zuvor in Jugoslawien und später in Polen, Belohnungscharakter. Am 10. Juli war von Eisenhower ein Lebensmittelprogramm gestartet worden. Bis Mitte Oktober 1953 holten DDR-Bürger rund 5,5 Millionen Pakete von den Ausgabestellen in Westberlin und reisten dafür sogar aus entlegenen Gebieten an.
Fast genau drei Jahre später begann der Aufstand im polnischen Posen (Poznan), der wiederum zum direkten Vorbild für die anschließende Ungarische Revolution im Oktober und November 1956 wurde. War im Juni 1953 der Tod Stalins eine wichtige Zäsur gewesen, die die Aufständischen beflügelte, war es nun die Abrechnung Chruschtschows mit seinem Vorgänger auf dem XX. Parteitag der KPdSU im Februar 1956. Das folgende politische «Tauwetter» war eine wichtige Voraussetzung für beide Aufstände. Auch hier war der Westen im Vorfeld aktiv beteiligt gewesen. Chruschtschows Abrechnungsrede, die den Westen im April 1956 mit Hilfe der israelischen Geheimdienste Mossad und Shin Beth aus dem Kreis um den als «Titoisten» politisch kaltgestellten ehemaligen polnischen Parteichef Wladislaw Gomulka erreicht hatte, verstand man hier als «pures Gold» im Kalten Krieg, wie George Kennan später bekannte. 11 Der Text war so wichtig, daß er vom amerikanischen Geheimdienst in Massenauflage nachgedruckt und durch Flugblätter im gesamten Ostblock bekannt gemacht wurde, um die nationale Opposition zu stärken.
Die Unruhen in Polen begannen am 22. Juni 1956 wiederum als klassische Arbeiterdemonstration mit vielen Übereinstimmungen zur Situation in der Tschechoslowakei und der DDR drei Jahre zuvor. 12 Kein Wunder, daß die DDR-Führung, die auch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder ein Übergreifen von Unruhen gerade aus Polen fürchtete, 1956 alarmiert war. Im Zentrum des
Aufstands, im westpolnischen Poznan, gab es zwar besondere wirtschaftliche und politische Bedingungen. Grundsätzlich jedoch entsprach die dortige Stimmung der politischen Atmosphäre im übrigen Land. Die Kollektivierung und Förderung der Industrialisierung hatten mehr wirtschaftliche Probleme als Lösungen erzeugt, die Preise für Konsumgüter waren auch hier wesentlich schneller als die Löhne gestiegen. Ebenso spielte der Ärger über Normerhöhungen wieder eine wichtige Rolle. Im Vergleich zu den vorangegangenen Aufständen war allerdings neu, daß die polnische Presse die Entwicklung bereits seit 1954 mit scharfer Kritik verfolgte und die Bevölkerung relativ umfassend über Fehlentwicklungen informiert war. Auch hier wollte man zunächst verhandeln. Nachdem die Gespräche mit der Regierung Cyrankie-wicz in Warschau bis zum 27. Juni gescheitert waren, standen am folgenden Tag rund 100 000 Menschen auf den Straßen von Posen, wo sich die Demonstration erneut schnell radikalisierte. Nach dem Singen religiöser und nationaler Lieder wurde zunächst das Stadtgefängnis gestürmt. Die Schüsse der Polizei und Armee waren mit eigenen Waffen beantwortet worden. Von diesem Punkt an war die Arbeiterdemonstration auch hier zu einem Volksaufstand geworden. Die offizielle Bilanz entsprach auffallend genau der des 17.Juni. 53 Personen wurden getötet, etwa 200 verletzt. Trotzdem konnten die Reformer zunächst einen Sieg für sich verbuchen. Für die Kollektivierung bedeutete das Jahr 1956 tatsächlich das Ende, und in rund sechzig Prozent der Betriebe außerhalb der Landwirtschaft konnte man bis zum September 1957 einen eigenen Arbeiterrat einrichten. Auch die Katholische Kirche profitierte. Inhaftierte Geistliche wurden freigelassen, und seit Mitte Dezember 1956 war an den polnischen Schulen sogar wieder Religionsunterricht möglich. Diese Liberalisierung fand allerdings mit der Wahl des ursprünglich als Hoffnungsträger geltenden Gomulka
Weitere Kostenlose Bücher