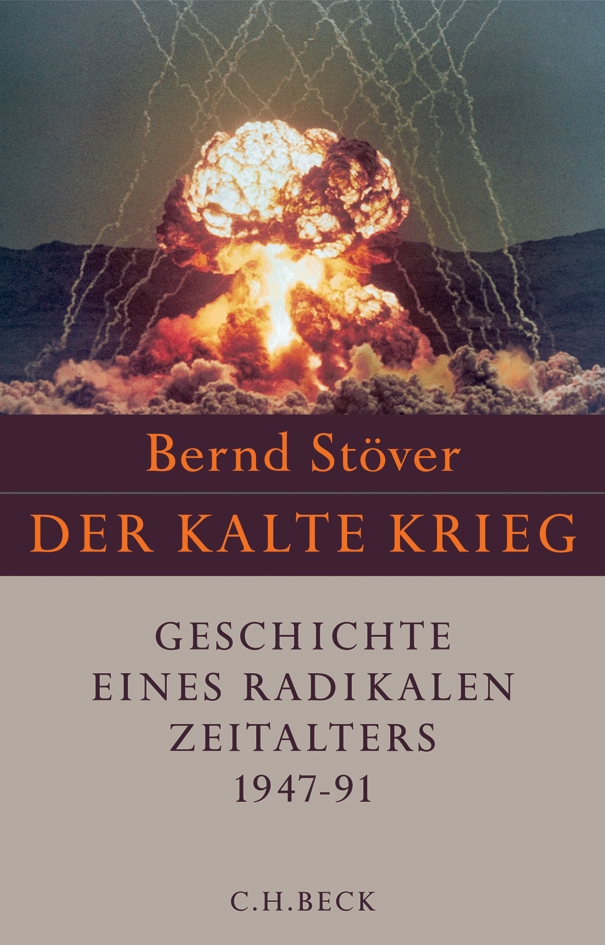![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
1953 brachte man in dieser Operation Valuable (Nutzen) genannten Aktion immer wieder neue Agentengruppen nach Albanien, die allerdings ebenso regelmäßig verhaftet wurden. Angesichts der Erfolglosigkeit stiegen bereits 1952 die Briten aus. 48 Schließlich gaben auch die Amerikaner auf. Die Gründe für das Scheitern der «Revolutionen» wurden erst viele Jahre später bekannt. Zum einen waren die Aktionen von Kim Philby, einem britischen Agenten in sowjetischen Diensten, weitergegeben worden. In seinen 1968 erschienenen Memoiren, My Silent War, gab der 1963 in die UdSSR geflohene Philby unter anderem diese Details preis. Der zweite Grund für das Scheitern in Albanien war langfristig folgenreicher: Es gab in den westlichen Geheimdiensten kontinuierlich krasse Fehleinschätzungen zu den Chancen eines Umsturzes im Ostblock. Bei dem gleichzeitig mit den albanischen Operationen begonnenen und ähnlich geplanten Umsturzversuch in Jugoslawien kamen haarsträubende Pannen hinzu. Unter anderem waren die abgesetzten «Revolutionsführer» in amerikanische Luftwaffenuniformen eingekleidet worden, was zu ihrer sofortigen Verhaftung führte. Trotzdem folgten weitere Umsturzversuche oder zumindest der Vorlauf dazu, ab 1951 für die Ukraine, für die Baltischen Staaten und für den Kaukasus. In der Sowjetunion wurden Bemühungen, antikommunistische Zellen einzurichten, bis weit in die fünfziger Jahre hinein fortgesetzt. 49 Auch hier gab man sie schließlich aufgrund kontinuierlicher Erfolglosigkeit auf. Nur in der Dritten Welt blieb es bis zum Ende des Kalten Krieges bei dieser Strategie. Die großangelegte Invasion von exilkubanischen Truppen auf Kuba am 15. April 1961 scheiterte bekanntlich, nachdem die US-Regierung die zugesagte Luftunterstützung nicht leistete. Aber auch in Asien und Afrika wurden diese Aktionen fortgeführt.
Vorbereitungen für den Umsturz mit Hilfe bewaffneter Aufstände von «Freiheitskämpfern» traf auch die UdSSR. Unter anderem wurden sie seit 1961 in Mittelamerika eingeleitet, wo man mit Hilfe Kubas insbesondere in Nicaragua und Costa Rica tätig wurde. Seit 1966 waren die nicaraguanischen Sandinisten auch für die Unterwanderung der USA vorgesehen. 50 Entsprechende Ausbildungslager wurden damals auf der mexikanischen Seite der amerikanischen Südgrenze eingerichtet. Auch aus der Kolonialherrschaft in die Unabhängigkeit entlassene afrikanische und asiatische Staaten wurden zum Ziel solcher Operationen, ebenso aber auch Westeuropa. Zur politischen Destabilisierung Großbritanniens setzte das KGB zum Beispiel auf die terroristische Irisch-Republikanische Armee (IRA). In der Bundesrepublik baute man unter anderem auf die «Rote Armee Fraktion» (RAF). Eine der größten Überraschungen nach der «Wende» 1989 war die Erkenntnis, daß selbst bundesdeutsche Terroristen Ausbildung und Unterschlupf hinter dem Eisernen Vorhang gefunden hatten, wenngleich auch die Amerikaner mit terroristischen Gruppen zusammenarbeiteten. Speziell für den Einsatz in der Bundesrepublik waren vom MfS bereits seit Anfang der fünfziger Jahre «Partisaneneinheiten» aufgestellt worden, die seit den sechziger Jahren immer mehr professionalisiert worden waren. Systematisch waren für das Kontingent «AGM/S» schließlich etwa dreieinhalbtausend Kämpfer ausgebildet worden, für die man nicht nur 346 militärische und zivile Angriffsziele ausspähte, sondern gezielt Waffenlager anlegte. 51 Auch rund 250 Westdeutsche waren als «Partisanen» beteiligt, die in den MfS-Akten als «Gruppe Förster» geführt wurden. 1968/69, also in jener Phase des Kalten Krieges gegründet, in der die Entspannungsbemühungen die internationalen Beziehungen dominierten, und mit einem Millionenetat ausgestattet, übten sie über Jahrzehnte den Partisanenkrieg gegen die Bundesrepublik. 52 Nach dem Ende des Kalten Krieges 1991 wurden in Westeuropa zahlreiche der von beiden Seiten eingerichteten und mit Sprengstoff gesicherten Waffenlager für solche Gruppen ausgehoben, die nach sowjetischen Insiderinformatio-nen auch in Nordamerika, Israel oder Japan existieren sollen.
Zu den wohl dunkelsten Aspekten des Geheimdienstkriegs gehörten die Attentate. Die Liste dieser im Jargon beider Seiten als «nasse Sachen» bezeichneten Aktionen ist lang, und einige Fälle werden sich vielleicht niemals ganz aufklären lassen. Von amerikanischer Seite wurde unter anderem die Ermordung des kubanischen Staatschefs Fidel Castro und des kongolesischen Politikers Patrice
Weitere Kostenlose Bücher