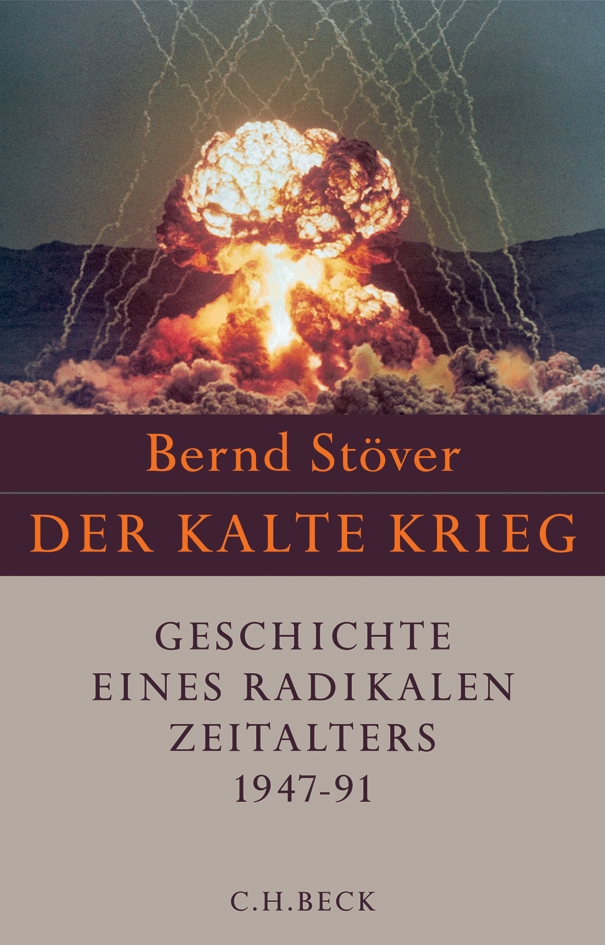![Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters]()
Der Kalte Krieg 1947-1991 - Geschichte eines radikalen Zeitalters
die Verfestigung der Teilung als ein weiteres Ergebnis des Kalten Krieges zur Normalität. Das Thema Wiedervereinigung verlor kontinuierlich an Bedeutung, wie die regelmäßigen Umfragen zeigten. 11 Auch der Eiserne Vorhang, der DDR-Bürger wie die Bevölkerung anderer Ostblockstaaten daran hinderte, in den Westen zu reisen, stand zwar vor und nach dem Mauerbau 1961 im Mittelpunkt vieler Reden. Im Alltagsbewußtsein der meisten Deutschen war er jedoch viel weniger präsent, als es im Rückblick scheinen mag. Selbst in Berlin, das auch im Alltag besonders stark von der Teilung betroffen war, wurde die Mauer und alles, was mit ihr zusammenhing, weitgehend zur Normalität, wenn nicht gerade blutige Ereignisse - so etwa erschossene DDR-Flüchtlinge im Grenzstreifen - ihre Existenz drastisch ins Gedächtnis riefen. Reisen, die in den fünfziger Jahren zunächst etwa jeden zehnten Westdeutschen, ab Ende der sechziger Jahre die Mehrheit der Bundesbürger vor allem ins westliche Ausland brachten, führten später DDR-Bürger in andere Länder des Ostblocks, etwa nach Ungarn und Bulgarien oder zumindest in heimische Regionen. Auch dies wurde in gewissem Rahmen zur Normalität. Daß allerdings 1989 viele ostdeutsche Ungarn-Urlauber die Chance ergriffen, über die dort seit Mai geöffnete Grenze nach Österreich zu fahren, spricht dafür, daß die Reisefreiheit, trotz der Alltäglichkeit der Grenze, einer der am meisten vermißten Inhalte im «realen Sozialismus» geblieben war.
Ebenso wie eine Normalität des Kalten Krieges gab es auch ein spezifisches Bewußtsein für Krisen. Während in der «ersten Welt», so im hochgerüsteten Mitteleuropa, politische Ausnahmezustände vor allem die erste Hälfte des Kalten Krieges bestimmt hatten, waren Entwicklungsländer, die in den Sechzigern in großer Zahl in die Unabhängigkeit aus der Kolonialherrschaft entlassen wurden, nahezu kontinuierlich von den Spannungsfällen des globalen Konflikts betroffen. Faktisch eskalierte hier der Kalte Krieg um so mehr, je stärker er vor allem in Europa an politisch-militäri-scher Brisanz verlor. Die Kubakrise begann 1962, als in Mitteleuropa die Zweite Berlinkrise mit dem Mauerbau 1961 gerade dem Ende zuging und eine allmähliche Beruhigung eintrat. Die militärische Eskalation im Vietnamkrieg, die sich dann nach und nach auf die Nachbarländer ausdehnte, ging einher mit dem Beginn der Entspannungspolitik in Mitteleuropa. Kontinuierlich blieben darüber hinaus Entwicklungsländer insbesondere von den Folgen der Atomtests betroffen. Ganze Inseln wurden evakuiert, über Jahrhunderte ansässige Bevölkerungsgruppen im Namen der nationalen Sicherheit der Großmächte vertrieben und als medizinische Versuchsobjekte mißbraucht. Auf dem französischen Testgelände Mururoa im Pazifik wurden noch in den achtziger Jahren trotz internationaler Proteste nukleare Sprengsätze gezündet.
In welcher Weise sich Normalitätsgefühl und Krisenbewußtsein zueinander verhielten, machte die erstmals 1947 auf dem Bulletin of the Atomic Scientists präsentierte sogenannte Doomsday Clock deutlich. 12 Die Weltuntergangsuhr, die als Anzeige für die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Krieges seitdem regelmäßig auf dem Titel der Zeitschrift abgedruckt wurde, sollte veranschaulichen, wie rasch die totale atomare Zerstörung die scheinbare Normalität des Alltags erreichen konnte. Später wurde sie in Krisen- oder Entspannungszeiten per Hand öffentlich vor- oder aber auch wieder zurückgestellt. Die Uhr, die zum Logo der Zeitschrift der kritischen Atomwissenschaftler wurde, stand 1947 auf sieben Minuten vor zwölf Uhr Mitternacht oder - je nach Temperament - kurz vor High Noon. Mit der Zündung der ersten sowjetischen Atombombe rückte sie 1949 auf drei Minuten, mit der sowjetischen H-Bombe
1953 sogar auf zwei Minuten an den Weltuntergang. Diesen dramatischen Stand erreichte die Doomsday Clock niemals wieder. Am nächsten rückte sie noch einmal 1981 an den prognostizierten Weltuntergang: Nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Ronald Reagan stand sie vier, 1984 drei Minuten vor zwölf. Auch wenn dies eine spezifisch amerikanische Erfindung war, spiegelten europäische und speziell deutsche Romane das gleiche Neben-und Miteinander von Normalitätsgefühl und Krisenbewußtsein im Kalten Krieg wider. 13 Wolfgang Koeppen, ein vor allem in der Bundesrepublik, später auch in der DDR viel gelesener Autor, faßte in seinem 1951 erschienenen Roman Tauben im Gras
Weitere Kostenlose Bücher