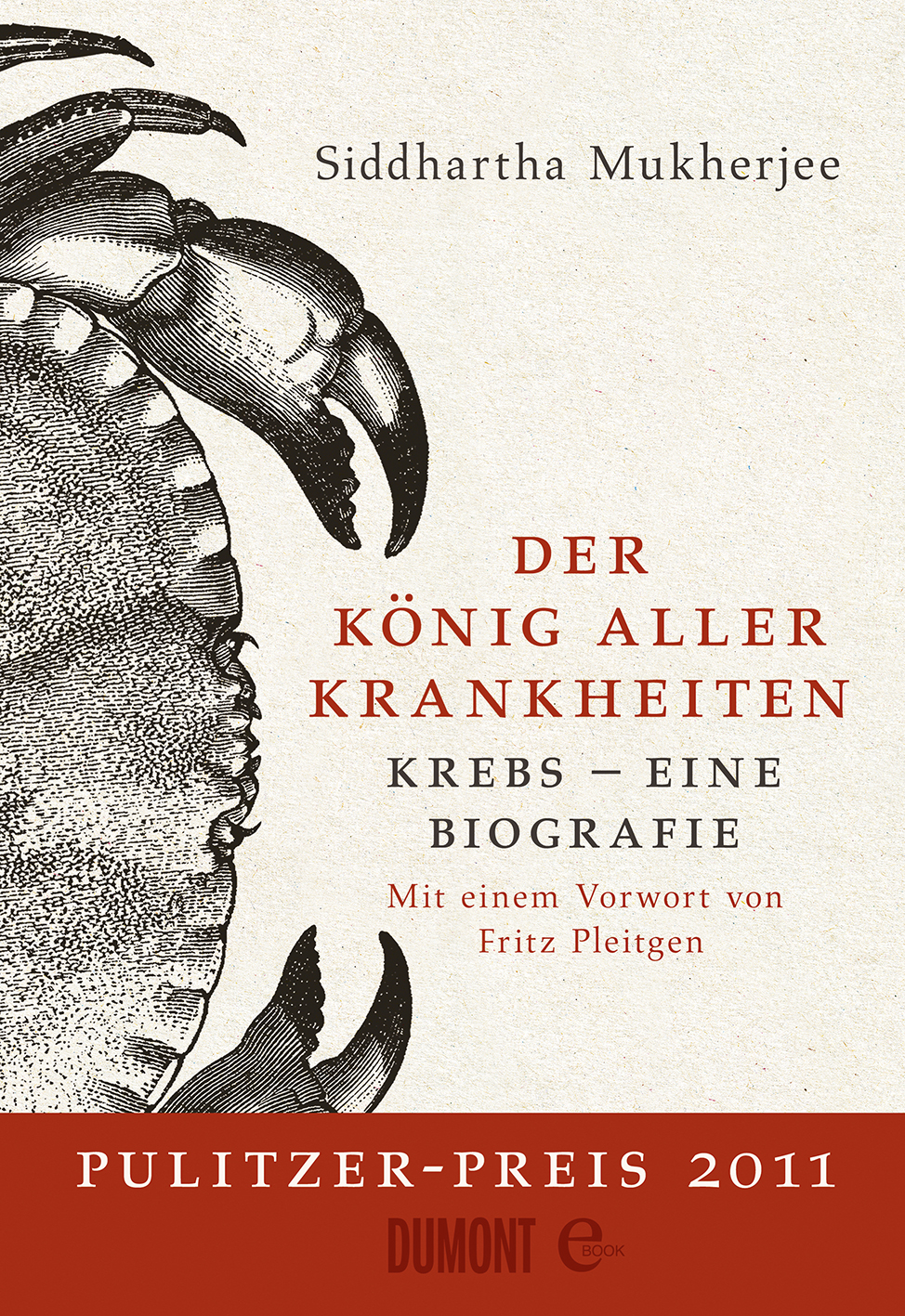![Der Koenig aller Krankheiten - Krebs, eine Biografie]()
Der Koenig aller Krankheiten - Krebs, eine Biografie
unserer Geschichte einzigartig ist. Es wäre ein Sieg über unsere eigene Zwangsläufigkeit – ein Sieg über unser Genom.
Um uns zu vergegenwärtigen, wie so ein Sieg aussehen könnte, lassen Sie uns ein Gedankenexperiment machen. Erinnern wir uns an Atossa, die Perserkönigin, die um 500 v. Chr. wahrscheinlich Brustkrebs hatte. * Stellen wir uns vor, dass sie durch die Zeit reist und in jeder Ära wiederauftaucht. Sie ist ein Dorian Gray des Krebses – sie folgt dem Bogen der Geschichte, und ihr Tumor, in Zustand und Verhalten erstarrt, bleibt stets derselbe. An Atossas Fall können wir die erzielten Fortschritte in der Therapie rekapitulieren und seine Zukunft betrachten. Inwieweit haben sich ihre Behandlung und Prognose in den letzten viertausend Jahren verändert, wie wird es Atossa in unserem neuen Jahrtausend ergehen?
* Wie schon erwähnt, wissen wir nicht, woran Atossa wirklich litt, denn um 500 v. Chr. wurde »Krebs« weder verstanden, noch war er beschrieben.
Versetzen wir sie zuerst weit zurück ins dritte vorchristliche Jahrtausend und an Imhoteps Klinik in Ägypten. Imhotep hat einen Namen für ihre Krankheit, eine Hieroglyphe, die wir nicht aussprechen können. Er stellt eine Diagnose, sagt dann aber demütig: »Es gibt keine Behandlung«, und schließt den Fall ab.
Um 500 v. Chr., in ihrer eigenen Zeit, verordnet sich Atossa die primitivste Form der Mastektomie und lässt sie von ihrem griechischen Sklaven durchführen. Zweihundert Jahre später, in Thrakien, identifiziert Hippokrates ihren Tumor als karkinos und gibt ihrer Krankheit einen Namen, der für alle Zeit hängen bleibt. 168 n. Chr. vermutet Claudius Galen eine universale Ursache, eine systemische Überdosis schwarzer Galle: gestaute melancholia , die sich als Tumor Bahn bricht.
Tausend Jahre huschen vorüber; Atossas gestaute schwarze Galle wird aus ihrem Körper ausgetrieben, doch der Tumor wächst weiter, kehrt zurück, befällt umliegende Gewebe, bildet Metastasen. Mittelalterliche Chirurgen verstehen wenig von Atossas Krankheit, rücken ihrem Krebs aber mit Messern und Skalpellen zu Leibe. Sie behandeln mit Froschblut, Bleiplatten, Ziegenkot, Weihwasser, Krabbenpaste und ätzenden Flüssigkeiten. 1778 weist John Hunter an seiner Klinik in London Atossas Krebs ein Stadium zu: Ist er ein früher, lokal begrenzter Tumor oder ein später, fortgeschrittener, invasiver Krebs? Im ersten Fall empfiehlt Hunter eine lokale Operation; im zweiten nur noch »ferne Sympathie«.
Als Atossa im neunzehnten Jahrhundert wiederauftaucht, lernt sie eine neue Welt der Chirurgie kennen. 1890 wird Atossas Brustkrebs an Halsteds Klinik in Baltimore mit der kühnsten und endgültigsten Therapie behandelt, die man bis dahin kennt: der radikalen Mastektomie, bei der nicht nur das Karzinom großräumig herausgeschnitten, sondern auch die tiefen Brustmuskeln und Lymphknoten in den Achselhöhlen und das Schlüsselbein entfernt werden. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts versuchen Strahlentherapeuten, den Tumor lokal durch Röntgenstrahlung auszumerzen. In den fünfziger Jahren lernt eine neue Generation von Chirurgen, die beiden Strategien zu kombinieren und in gemäßigter Form anzuwenden. Atossas Krebs wird lokal durch einfache Mastektomie oder durch Lumpektomie mit anschließender Bestrahlung behandelt.
In den siebziger Jahren entstehen neue therapeutische Strategien. Auf Atossas Operation folgt eine adjuvante Kombinationschemotherapie, um die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls zu verringern. Ihr Tumor wird auf den Östrogenrezeptor getestet, und als der Befund positiv ausfällt, wird ihr zusätzlich Tamoxifen verordnet, das Antiöstrogen, um einem Rückfall vorzubeugen. 1986 wird in ihrem Tumor ferner eine Her-2 -Überexpression entdeckt, und neben Operation, Bestrahlung, adjuvanter Chemotherapie und Tamoxifen erhält sie eine zielgenaue Therapie mit Herceptin.
Welche Auswirkung diese Interventionen 4 jeweils auf Atossas Überleben haben, lässt sich unmöglich genau bestimmen. Die wandelbare Landschaft klinischer Studien erlaubt keinen direkten Vergleich zwischen Atossas Schicksal um 500 v. Chr. und ihrem Schicksal im Jahr 1989. Doch Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, Hormonbehandlung und zielgerichtete Therapie dürften ihr Leben um siebzehn bis dreißig Jahre verlängert haben. Erfährt sie ihre Diagnose mit, sagen wir, vierzig Jahren, kann Atossa durchaus damit rechnen, ihren Sechzigsten zu feiern.
Mitte der neunziger Jahre tritt
Weitere Kostenlose Bücher