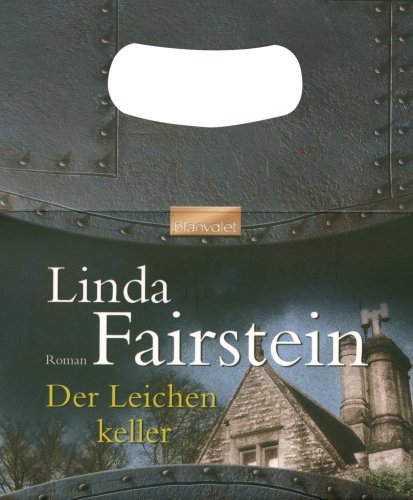![Der Leichenkeller]()
Der Leichenkeller
Geh’n wir.«
Wir bogen um die Ecke in den dunklen, ruhigen Hauptkorridor. Eine Gestalt saß mit dem Rücken zu uns am Sicherheitsschalter gegenüber den Aufzügen und sprach in ein Handy. Zu dieser späten Stunde waren nur noch die Schalter in der Eingangslobby besetzt.
Als wir den Tisch passierten, drehte sich der Mann um und sprach uns an. »Ms. Cooper? Alex? Könnte ich Sie kurz sprechen?« Es war Graham Hoyt.
Ich legte Mike die Hand auf den Arm; ich wusste, dass er das als Zeichen auffassen würde, bei mir zu bleiben. Ich wollte einen Zeugen, wenn ich mich mit Dulles’ Anwalt unterhielt. »Sicher. Wie sind Sie um diese Uhrzeit noch hereingekommen?«
»Ich habe einen alten Kommilitonen besucht und hatte eine Idee, über die ich mich mit Ihnen unterhalten wollte. Ich bin auf dem Weg nach draußen an Ihrem Büro vorbei, und als ich Stimmen hörte, beschloss ich, auf Sie zu warten.«
»Wer ist denn Ihr Kommilitone?«, fragte Mike mit einem misstrauischen Unterton in der Stimme.
»Jack Kliger, von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität. Ich habe ihm eine Flasche Champagner vorbeigebracht. Er und seine Frau haben gerade Nachwuchs bekommen.«
Jack war ein bisschen älter als ich und hatte an der Columbia-Universität Jura studiert. Es stimmte, dass seine Frau vor kurzem ihr drittes Kind entbunden hatte. Ich könnte ihn nächste Woche nach Hoyt fragen, aber sie schienen sich offensichtlich zu kennen.
»Worüber wollten Sie mit mir sprechen? Ich habe eine Verabredung und würde gerne pünktlich sein.«
Er sah Chapman an, dann wieder mich.
»Mike Chapman«, stellte ich vor. »Mordkommission. Er bleibt hier.«
»Ich bin in einer schwierigen Lage«, begann Hoyt zögerlich. »Peter Robelon weiß nicht, dass ich hier bin. Er und Andrew Tripping würden mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn sie wüssten, dass ich mit Ihnen über Dulles rede. Aber ich bin der Meinung, dass Sie und ich uns auf eine Lösung einigen sollten, die im besten Interesse des Kindes ist.«
»Daran ist doch etwas faul, Mr. Hoyt.« Ich ging zum Aufzug und drückte den Knopf. »Haben Sie dem Gericht nicht gestern erst erzählt, dass Dulles’ Verletzungen vom Lacrosse herrührten? Ich glaube nicht, dass wir uns über irgendetwas einigen können.«
»Sie haben einen Detective hier als Zeugen. Was, wenn ich Ihnen sage, dass ich es einrichten kann, Sie mit dem Jungen sprechen zu lassen?«
Ich drehte mich um und musterte ihn scharf.
»Ich wäre dazu bereit, Ms. Cooper.«
»Warum zum Teufel haben Sie dann dem Richter dieses Märchen über seine blauen Flecken aufgetischt?«
»Weil ich neben Peter Robelon und Andrew Tripping stand. Das war die offizielle Version der Verteidigung für diesen Teil der Anklage. Das wussten Sie.«
»Alles der Reihe nach. Wissen Sie, wo sich der Junge im Augenblick befindet?« Ich deutete aus dem Fenster hinüber zur Abteilung für Kindesmissbrauch. »Zur Zeit findet eine groß angelegte Suchaktion nach dem Jungen statt. Falls Sie etwas wissen, ist das unsere erste Pflicht.«
»Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich habe keinen Schimmer, wo er ist. Aber ich glaube, dass Dulles, falls er von den Wykoffs weggelaufen ist – und ich kann nur hoffen, dass ihn niemand entführt hat –, eher meine Frau oder mich kontaktieren wird als Robelon.«
»Weil Sie sein Verfahrenspfleger sind?«, fragte ich.
»Weil wir ihn seit seiner Geburt kennen.«
»Wie das?«
»Andrew, Peter und ich haben alle drei zusammen in Yale studiert. Ich habe Peter im ersten Studienjahr kennen gelernt. Wir haben viele Kurse zusammen belegt und danach beide Jura studiert.«
»Und Andrew?«
Hoyt war direkt. »Ich mochte Andrew nie besonders. Ich war bis über beide Ohren in die Frau verliebt, die er später geheiratet hat. Dulles’ Mutter, Sally Tripping. Wir sind ein paar Jahre zusammen gewesen. Sie war auch in unserem Jahrgang. Sally hat mich wegen Andrew verlassen.«
»Das spricht nicht für Sie, Kumpel«, sagte Chapman.
»Andrews Krankheit war damals noch nicht ersichtlich. Er ist sehr intelligent, möglicherweise sogar brillant. Er hat erst nach dem Studium durchgedreht. Ich glaube, er wurde beim Militär mit Schizophrenie diagnostiziert.«
»Hatten Sie mit Sally bis zu ihrem Tod – ihrem Selbstmord – Kontakt?«, fragte ich.
»Leider nein. Das ist einer der Gründe, warum ich dem Jungen helfen möchte. Ich fühle mich wohl ein bisschen schuldig. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wenn ich ihr ein besserer Freund
Weitere Kostenlose Bücher