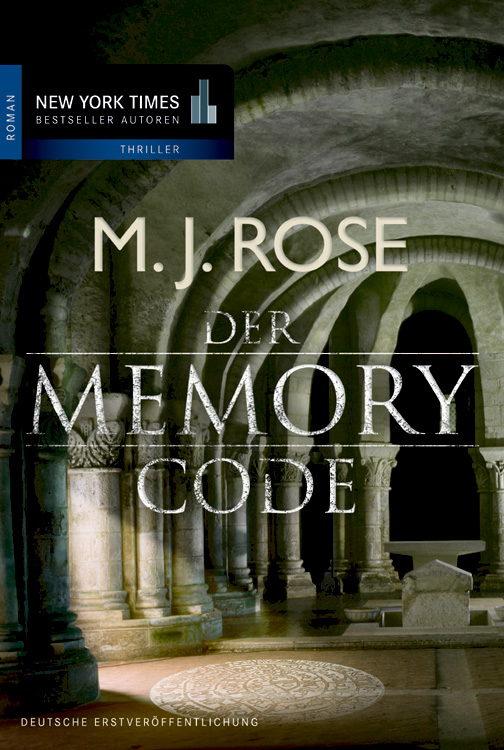![Der Memory Code]()
Der Memory Code
Labyrinths und zu der Erkenntnis, wieso er diesem Weg hatte folgen müssen.
16. KAPITEL
J ulius und Sabina
Rom – 391 nach Christus
An jenem Morgen verließ er die Stadt schon früh, als der Himmel noch dunkel war und noch kein Sonnenaufgang hinter dem Horizont glühte. Die Straßen waren verwaist bis auf ein paar streunende Katzen, die sich nicht stören ließen.
Sabina foppte ihn sonst immer damit, dass er zu allem zu früh eintraf, doch inzwischen war dringend Vorsicht geboten. Es war klüger, wenn er sich im Schutze der Dunkelheit auf den Weg machte, um vor Tagesanbruch zum Hain zu gelangen.
Als er am Kaiserpalast vorbeikam, fiel sein Blick wie immer auf den aufwendigen, in die Mauer gemeißelten Kalender. Der Gang der Zeit hatte eine neue und beängstigende Bedeutung erhalten. Wie viele Tage, Wochen und Monate mochten ihnen noch vergönnt sein, ehe sich alles ringsum bis zur Unkenntlichkeit verändert haben würde? Wie lange mochte er noch in der Lage sein, die Opfer und Riten zu zelebrieren, für die er die Verantwortung trug? Wie lange durften sie wohl noch an den uralten Feierlichkeiten und Kulthandlungen teilnehmen, die ihnen von ihren Vätern und Vorvätern überliefert worden waren?
In den vergangenen zwei Jahren hatte sich die Zahl seiner Pflichten verdoppelt. Der Nachwuchs blieb aus, und immer weniger Männer traten in die Ausbildungskollegien für das Priesteramt ein. Zusätzlich zu seinem Dienst als Aufseher der Vestalinnen bekleidete er nun auch noch das Amt des Flamen Furinalis, des Priesters der Furina. Er hütete den heiligen Hain mit der Grotte, die der Göttin Furina gehörte.
Nicht dem Imperator.
Nicht den machthungrigen Bischöfen in Mediolanum.
Sondern der Quellgöttin.
Jenseits des Palastes bog er in die Straße ein, die aus der Stadt hinausführte. Ein Mann hockte, allem Anschein nach weintrunken, schlafend vor einem viergeschossigen Gebäude. Den Rücken gegen die Wand gelehnt und das Kinn auf der Brust, hielt er die Arme seitlich ausgestreckt, die Handflächen dabei aufwärts gekehrt, als wolle er betteln. Irgendjemand hatte ihm etwas zu essen in die offene Hand gelegt. Es war nicht ungewöhnlich, dass nachts Hungerleider in den Gassen herumlungerten, obdachlos oder betrunken, und immer gab es Wohltäter, die sich ihrer erbarmten.
Nur stimmte mit diesem vermeintlichen Trunkenbold etwas nicht.
Noch ehe Julius es verstandesmäßig erfasste, ahnte er es schon intuitiv. Möglicherweise lag es daran, dass der Schädel des Mannes merkwürdig verdreht war und die Gestalt so vollkommen reglos dasaß. Als Julius dem Sitzenden unters Kinn griff und den Kopf anhob, stellte er fest, dass das Gewand vorn aufgeschlitzt und zerrissen war. Über die Vorderseite des Körpers zogen sich die gefürchteten gekreuzten Linien, eine senkrecht, die andere waagerecht – klaffende, noch bluttriefende Wunden, aus denen die Eingeweide quollen. Der Boden unter dem Sitzenden war bereits blutrot verfärbt.
Jetzt sah Julius das Gesicht. Der Tote war kein obdachloser Zecher; es war Claudius, ein Pontifex aus dem Collegium. Zum Zeichen der Schmach hatte man ihm in einem letzten rituellen Akt die Augen ausgestochen.
Und nun bemerkte Julius auch, was der arme Claudius da in den Händen hielt: Nicht etwa Essbares, sondern seine eigenen Augen.
Julius prallte entsetzt zurück. Welches Leid hatte man diesem Jüngling angetan? Aus welchem Grund? Um die unstillbare Machtgier des Imperators zu befriedigen? Und das Allerschlimmste: die Handlanger des Kaisers begriffen nicht einmal, dass er sie nur benutzte. Dass nichts Gutes von diesem Herrscher zu erwarten war.
“Flieh!”, wisperte eine Stimme. “Mach, dass du fortkommst!”
Es dauerte eine Weile, bis Julius die Alte erkannte, die da verborgen im Schatten kauerte und zu ihm herüberglotzte, das Weiße in den Augen schimmernd, auf den Lippen ein fratzenhaftes Grinsen.
“Ich hab es euch vorausgesagt”, krächzte sie mit heiserer Stimme, als habe man ihr die Zunge mit einem Reibeisen bearbeitet. “Euch allen. Aber es hört ja keiner auf mich. Jetzt geht es los. Und das …” – mit klauenartigem, knorrigem Finger wies sie in die Richtung, aus der Julius gekommen war – “… ist erst der Anfang.”
Es war eine der alten Vetteln, die im Circus Maximus die Zukunft voraussagten und um Münzen bettelten. Julius kannte sie. Solange er zurückdenken konnte, gehörte sie quasi zum Inventar. Was sie da aber gerade gesagt hatte, war keine nebulöse Weissagung,
Weitere Kostenlose Bücher