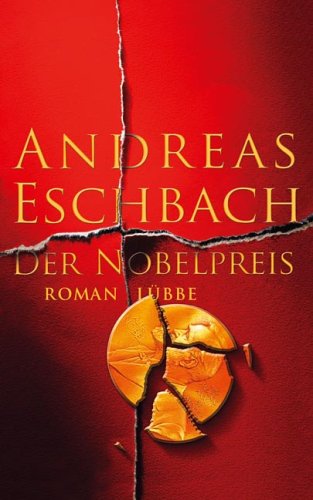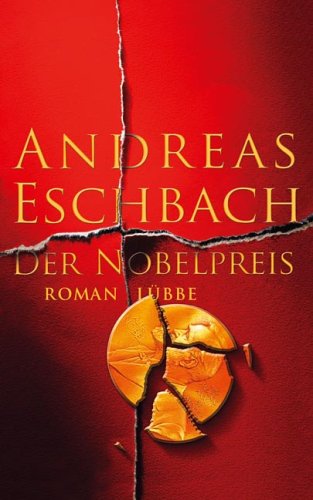
Der Nobelpreis
Preise aus heiterem Himmel getroffen hat –, doch in der Regel hatten sie gewusst oder zumindest geahnt, dass sie als Kandidaten gehandelt worden waren. Zwar bemühten sich alle Institutionen des Nobelpreises um absolute Verschwiegenheit bis zum Augenblick der Bekanntgabe der Preisträger, aber die Welt der Wissenschaft ist überschaubar und die Kommunikation untereinander intensiv. Bisweilen ist es nötig, einen Kollegen des Nominierten vertraulich um ein Gutachten zu bitten, und in solchen Fällen zeigt sich oft, dass manche den Begriff Vertraulichkeit etwas anders definieren als das Nobelkomitee.
Das Telefonat war dazu da, dem Laureaten einen Vorsprung vor den Medien zu verschaffen, ihm die Zeit zu geben, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass er von nun an dem Olymp angehörte, und Zeit, sich passende Antworten auf die Fragen auszudenken, die kommen würden. Das Telefonat sollte verdeutlichen, dass der Preis in erster Linie den Preisträgern galt und dass alles andere – die Berichterstattung darüber, die Aufregungen, Enttäuschungen und Anfeindungen – nur Nebeneffekte waren, atmosphärische Störungen sozusagen. Das Telefonat diente jedoch nicht dazu, das Einverständnis des Erkorenen einzuholen. Es spielte keine Rolle, ob der Laureat mit seiner Ernennung einverstanden war. Man konnte den Nobelpreis ablehnen. Einige hatten das getan, Jean-Paul Sartre etwa, aus Gründen, über die viel diskutiert worden war; im Grunde hatte ihm aber die Ablehnung des Nobelpreises mehr Ruhm eingebracht als es dessen Annahme vermocht hätte. Doch auch derjenige, der ihn ablehnte, wurde in den Annalen als Preisträger verzeichnet. Es gab kein Entkommen vor dem Nobelpreis.
Manche der Angerufenen waren allerdings ehrlich überrascht. Manchmal einfach aus dem Grunde, dass sie die Falschen waren. Noch immer wurde gern die Geschichte des Chemienobelpreisträgers von 1979 erzählt, eines New Yorkers namens Herbert C. Brown, dessen Nummer das Nobelkomitee über die Telefonauskunft erfragte – und die falsche bekam: die eines gleichnamigen Arztes, der sich zwar auch sehr geehrt fühlte, aber bald feststellte, dass er unmöglich gemeint sein konnte. Eine andere Geschichte war passiert, als Hans-Olof schon mehrere Jahre am Institut gewesen war, ebenfalls im Bereich Chemie, der sich allem Anschein nach schwer damit tat, Telefonnummern ausfindig zu machen. 1992 hatte man vergebens versucht, den frisch gekürten Preisträger Rudolph Marcus ans Telefon zu bekommen, und schließlich einen Kollegen von ihm angerufen, in der Hoffnung, dass dieser wisse, wo der Laureat sich aufhielt. Der jedoch, ein Chemiker namens Harry B. Gray, hatte sich selber für einen möglichen Kandidaten gehalten, und die Frage des Komiteevorsitzenden hatte dem armen Mann beinahe einen Herzinfarkt verschafft.
Das zumindest, überlegte Hans-Olof düster, würde in diesem Fall nicht passieren. Erstens hielt sich Sofía Hernández Cruz in ihrem Labor in der Schweiz auf, wo die Uhren dieselbe Zeit anzeigten wie in Stockholm, und unter Garantie saß sie längst am Telefon.
Während die Vorsitzenden des Komitees und der Versammlung und ein paar andere sich anschickten, nach nebenan ins Nobelbüro zu gehen und dort das Telefonat zu tätigen, nahm Thunell Hans-Olof beiseite und sagte, ihn am Oberarm festhaltend, so leise, dass man es zehn Zentimeter weiter nicht mehr hören konnte: »Ich finde das äußerst beunruhigend. Ich hoffe sehr, dass dieses Ergebnis nicht am Ende tatsächlich durch Bestechung zustande gekommen ist.«
Hans-Olof schluckte. »In meinem Fall jedenfalls nicht«, erwiderte er mit dem hässlichen Gefühl zu lügen.
Thunell musterte ihn durchdringend, ließ ihn dann los und hieb ihm auf die Schultern. »Das weiß ich doch, Hans-Olof«, rief er mit einem etwas bemühten Lachen. »Das weiß ich doch.«
Dann ging er hinaus.
Die Minuten unmittelbar nach der Abstimmung, wenn die meist heftige Debatte vorüber und die Entscheidung gefallen war, endgültig und unwiderruflich, waren normalerweise von heiterer, bisweilen regelrecht ausgelassener Stimmung geprägt. Seit einigen Jahren konnte man im Versammlungsraum das Telefonat über eine Lautsprecheranlage mithören. Den Moment mitzuerleben, in dem ein hochverdienter Wissenschaftler erfuhr, dass ihm die höchste Ehrung zuteil wurde, die es in einem Wissenschaftlerleben gab, hatte etwas zutiefst Anrührendes, Beglückendes. »Besser als Weihnachten«, hatte jemand einmal gesagt.
Heute war das nicht so. Oder
Weitere Kostenlose Bücher