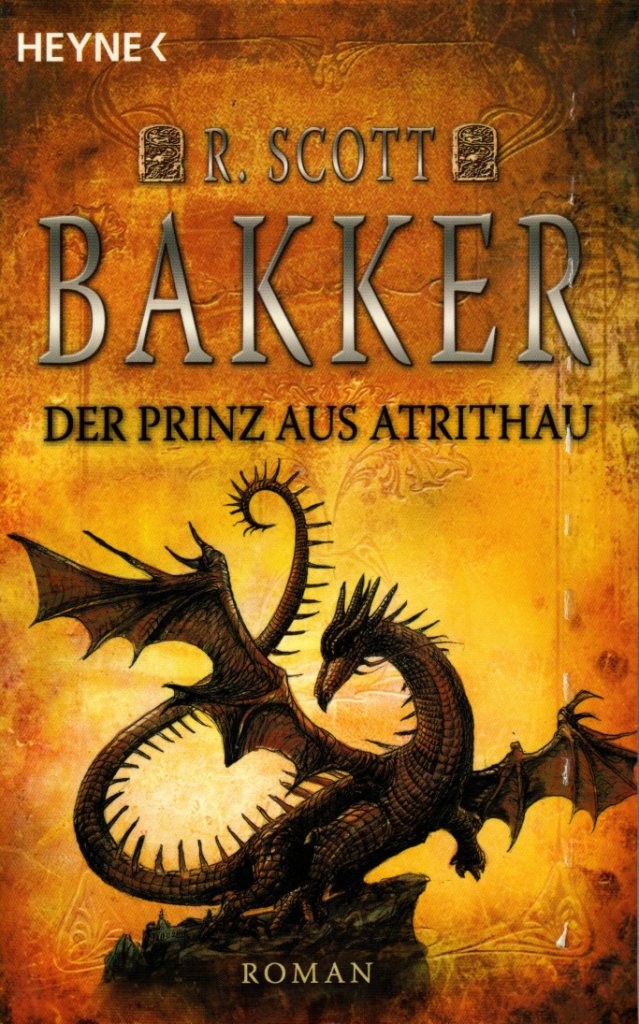![Der Prinz von Atrithau]()
Der Prinz von Atrithau
Wochen schon genossen sie Schutz und Gastfreundschaft des Barons – lange genug jedenfalls, um das Erstaunen über ihr Entkommen zu vergessen und immer mehr an die Verluste zu denken. Achamian begriff schnell, dass auch das Überleben überlebt sein wollte.
Er hustete und strampelte die Füße aus den Laken. Sein Pfleger aus Shigek – einer von zwei Sklaven, die Baron Shanipal ihm zugeteilt hatte – trat hinter einer mit Blumen bestickten Trennwand hervor. Der Baron, der zu den seltsamen Menschen gehörte, deren Liebenswürdigkeit oder Gemeinheit sich danach bemaß, wie überzeugend man auf seine Exzentrizität einging, hatte beschlossen, sie müssten leben wie die früheren Besitzer des Landguts. Offenbar schliefen die Kianene mit Sklaven in ihren Räumen – wie die Norsirai mit ihren Hunden.
Nachdem er sich gewaschen und angezogen hatte, durchstreifte Achamian die Säle des Landhauses auf der Suche nach Xinemus, der in der Nacht nicht in sein Zimmer zurückgekehrt war. Die Kianene hatten so viele Mahagonimöbel, weiche Teppiche und prächtige Gobelins zurückgelassen, dass Achamian fast glaubte, bei einem echten Granden der Fanim und nicht bei einem Baron der Inrithi zu Gast zu sein, der aus einer Laune heraus nach der Art eines Fanim lebte.
Unwillkürlich schimpfte er auf den Marschall, als er die Zimmer absuchte. Die Gesunden missgönnen den Kranken immer etwas, denn auf die körperlichen Handikaps anderer Rücksicht nehmen zu müssen, ist nicht gerade leicht, doch der Ärger, den Achamian empfand, war seltsam in sich gekehrt und in seiner Komplexität fast labyrinthartig. Mit Xinemus schien es von Tag zu Tag schwieriger zu werden.
In vieler Hinsicht war der Marschall sein ältester und bester Freund – dies schon ließ Achamian sich verantwortlich fühlen. Dass Xinemus geopfert, was er geopfert, und durchlitten, was er durchlitten hatte, um Achamian zu retten, verstärkte diese Verantwortung noch. Doch Xinemus litt noch immer. Trotz Sonne, Seide und gehorsamer Sklaven schrie er weiter in den Kellern von Iothiah, verriet weiter Geheimnisse, zerbiss sich weiter vor Schmerz die Zähne und schien sein Augenlicht jeden Tag aufs Neue zu verlieren. Und darum hielt er Achamian nicht einfach für verantwortlich, sondern klagte ihn an.
»Das ist der Lohn meiner Treue!«, hatte er mal gerufen. »Tränen meine Augenhöhlen? Meine Wangen jedenfalls fühlen sich trocken an. Oder verdorren meine Lider, Akka? Sag mir, wie sie ausschauen, denn ich kann nicht mehr sehen!«
»Niemand hat dich gebeten, mich zu retten!«, hatte Achamian geantwortet. Wie lange müsste er ungewollte Gefälligkeiten zurückzahlen? »Niemand hat dich um diese Torheit gebeten!«
»Esmi«, hatte Xinemus entgegnet, »hat mich darum gebeten.«
So sehr Achamian auch versuchte, Xinemus diese Wutanfälle zu vergeben: Ihr Gift drang tief in ihn ein. Er grübelte oft über die Grenzen seiner Verantwortung, als stünden sie zur Debatte. Was genau schuldete er seinem Freund? Manchmal sagte er sich, der wahre Xinemus sei gestorben und dieser blinde Tyrann sei nur ein Fremder. Lass ihn mit den anderen in der Gosse betteln! Bei anderer Gelegenheit versuchte er sich einzureden, Xinemus müsse einfach im Stich gelassen werden – und sei es nur, um ihm den verfluchten Adelsstolz zu rauben.
»Du hältst fest, was du loslassen musst«, sagte er einmal zu ihm, »und lässt los, was du festhalten musst. Das kann so nicht weitergehen, Xin. Du darfst nicht vergessen, wer du bist!«
Und doch war Xinemus nicht allein: Auch Achamian hatte sich unwiderruflich verändert.
Nicht ein einziges Mal hatte er um seinen Freund geweint. Und seit er den Scharlachspitzen entkommen war, war er nicht mehr schreiend aus Alpträumen geschreckt. Irgendwie fühlte er sich dazu einfach nicht… fähig. Er erinnerte sich seiner Empfindungen – der dröhnenden Ohren, der brennenden Augen, seiner zugeschnürten Kehle –, doch sie schienen ohne Wurzeln, ja abstrakt zu sein. Wie etwas, von dem man gelesen hatte, ohne es zu kennen.
Seltsamerweise schien Xinemus seine Tränen zu brauchen, als ob nicht die Qualen, nicht einmal die Blindheit das eigentlich Schlimme war, sondern die Tatsache, dass er und nicht Achamian schwach geworden war. Je mehr Xinemus aber seine Tränen zu brauchen schien, desto weniger verstand Achamian sie, was womöglich noch seltsamer war. Oft schienen sie in Gesprächen miteinander zu ringen, als wäre Xinemus der gescheiterte Vater, der sich bei dem Versuch,
Weitere Kostenlose Bücher