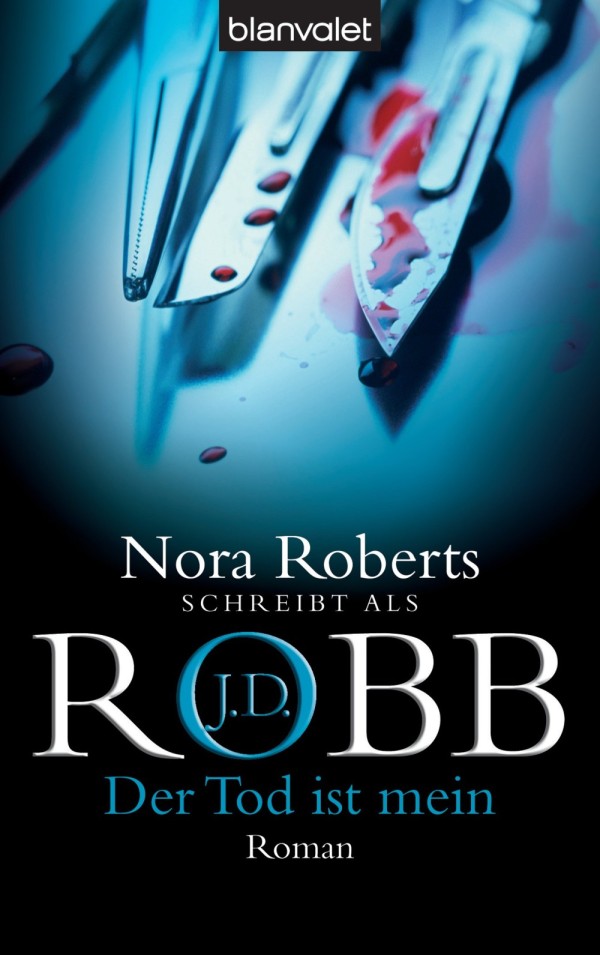![Der Tod ist mein]()
Der Tod ist mein
1
E s gab Menschen, für die war nicht der Tod, sondern das Leben der allergrößte Feind. Für die Geister, die wie Schatten durch das Dunkel glitten, die Junkies mit ihren blass pinkfarbenen Augen, die Fixer mit ihren zitternden Händen, war das Leben nichts weiter als eine gedankenlose Reise von einem Schuss zum nächsten, wobei die Zeit dazwischen eine Phase größten Elends darstellte.
Auch der Trip selbst war meistens voller Schmerzen, voll Verzweiflung und manchmal voll des Grauens.
Für die Armen und die Obdachlosen, die zum eisigen Beginn des Jahres 2059 im Untergrund von New York City hausten, waren Schmerz, Verzweiflung, Grauen ständige Begleiter. Für die geistig Verwirrten und die körperlich Behinderten, die durch das Sozialnetz fielen, war die Stadt nichts anderes als ein düsteres Verlies.
Natürlich gab es Hilfsprogramme. Schließlich war dies eine aufgeklärte Zeit. Das sagten zumindest die Politiker, die, wenn sie den Liberalen angehörten, stets nach teuren neuen Unterkünften, Schulen, Krankenhäusern, Ausbildungs- und Rehabilitationsmaßnahmen riefen, ohne dass es jemals einen Plan zur Finanzierung all dieser Projekte gab. Und waren die Konservativen an der Macht, beschnitten sie sogar den Minimaletat, den man Außenseitern der Gesellschaft zugestanden hatte, und schwangen große Reden über die Bedeutung der Familie und die ständige Verbesserung der Lebensqualität.
Natürlich konnten die, die bedürftig genug waren und die es ertrugen, aus der schmalen, kalten Hand der Wohlfahrt etwas anzunehmen, eine Unterkunft bekommen. Natürlich gab es Ausbildungs- und Hilfsprogramme für die Menschen, die es schafften, bei Verstand zu bleiben, bis die Mühle der Bürokratie, die die Antragsteller oft erdrückte, statt ihnen tatsächlich zu helfen, endlich mit dem Mahlen fertig war.
Doch noch immer mussten Kinder hungern, Frauen sich verkaufen, und noch immer brachten Männer andere für eine Hand voll Münzen um.
Egal wie aufgeklärt die Zeit war, die Natur der Menschen blieb so wenig kalkulierbar wie der Tod.
Für die Obdachlosen bedeutete der Januar in New York eisig kalte Nächte, gegen die mit einer Flasche Fusel oder ein paar ergatterten Tabletten nicht anzukommen war. Einige von ihnen gaben auf und schlurften zu den Unterkünften, wo sie unter dünnen Decken auf zerschlissenen Matratzen schnarchten und die wässrige Suppe zusammen mit den Scheiben faden Sojabrotes schlürften, die ihnen Soziologiestudentinnen mit leuchtenden Gesichtern auf die Teller schaufelten. Andere hielten, zu verloren oder nur zu stur, um ihr kleines Fleckchen Erde vorübergehend aufzugeben, ebenso bei Minusgraden aus.
Und viele, allzu viele, glitten während dieser bitterkalten Nächte lautlos vom Leben in den Tod.
Die Stadt hatte sie getötet, doch niemand nannte diese Akte Mord.
Als Lieutenant Eve Dallas vor Anbruch der Morgendämmerung in Richtung City fuhr, trommelte sie rastlos mit den Fingern auf dem Lenkrad. Der Tod eines Penners in der Bowery hätte nicht ihr Problem sein sollen. Er war Sache der »Mord-Light« genannten Abteilung, also der Leichensammler, die in den bekannten Obdachlosensiedlungen patrouillierten, um die Lebenden von den Toten zu trennen und die verbrauchten Körper zur Untersuchung, Identifizierung und anschließenden Entsorgung ins Leichenschauhaus zu verfrachten.
Es war ein prosaischer, unangenehmer Job, der meistens von denen übernommen wurde, die noch Hoffnung hatten, in das angesehenere Morddezernat zu kommen, oder bei denen die Hoffnung auf ein derartiges Wunder längst erloschen war. Die Mordkommission wurde nur dann gerufen, wenn der Tod eindeutig verdächtig oder infolge sichtbarer Gewaltanwendung eingetreten war.
Und, dachte Eve, hätte sie an diesem grässlich kalten Morgen nicht ausgerechnet Rufbereitschaft für einen solchen Fall gehabt, läge sie jetzt noch in ihrem schönen, warmen Bett bei ihrem wunderbaren Mann.
»Wahrscheinlich irgend so ein hypernervöser Anfänger, der auf einen Serienmörder hofft«, murmelte sie wütend.
Neben ihr riss Peabody den Mund zu einem lauten Gähnen auf. »Ich bin doch bestimmt vollkommen überflüssig hier«, erklärte sie und bedachte ihre Vorgesetzte unter ihrem schnurgeraden Pony hervor mit einem hoffnungsvollen Blick. »Sie könnten mich also an der nächsten Bushaltestelle absetzen, und dann wäre ich in zehn Minuten wieder bei mir zu Hause im Bett.«
»Wenn ich leide, leiden auch Sie.«
»Das gibt mir das Gefühl,
Weitere Kostenlose Bücher