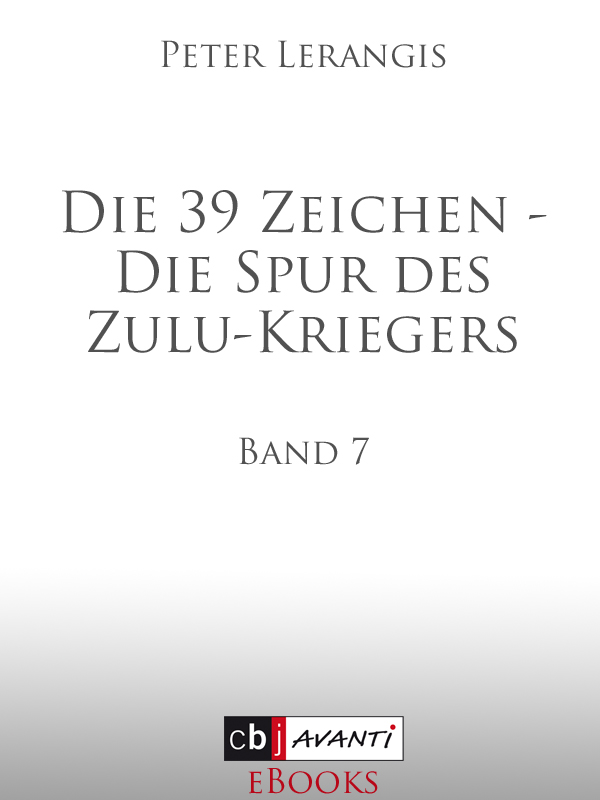![Die 39 Zeichen 07 - Die Spur des Zulu-Kriegers]()
Die 39 Zeichen 07 - Die Spur des Zulu-Kriegers
Amy. Ich meine, froh zu sein, dass er noch lebt. Ich glaube, Mama und Papa wären stolz auf dich. Sie haben das Leben geachtet. Das unterscheidet sie auch von einigen anderen Cahills. Und Madrigals.«
Amy dachte einen Moment nach. Er hatte recht. Wie ein Madrigal zu sein, war das schlimmstmögliche Schicksal, das sie sich vorstellen konnte.
Manchmal – aber auch wirklich nur manchmal – wollte sie ihren Bruder umarmen. Aber das letzte Mal, als sie es versucht hatte, hatte er danach »Kuschelfreie Zone« auf sein T-Shirt geschrieben. Also lächelte sie nur und fragte ihn: »Woher weißt du das, Dan? Du warst noch so klein, als sie starben. Erinnerst du dich überhaupt an sie?«
»Nicht im Kopf«, antwortete Dan und betrachtete die vorbeiziehende Landschaft. »Aber überall sonst …«
»Jetzt nach links abbiegen …«, ertönte eine beruhigende Stimme vom Armaturenbrett des Yugo.
»Danke, Carlos«, erwiderte Nellie grinsend. »Carlos werde ich heiraten. Ich sag ihm, was er tun soll, und er macht es einfach, ohne rumzunörgeln.«
Nellies neues Navigationssystem, das die drei Carlos getauft hatten, führte sie sicher in die Innenstadt von Johannesburg. Man sah schon eine Ansammlung von Wolkenkratzern aus Glas und Stahl. Sie stiegen zu einer schmalen, eleganten Struktur auf, die an ein riesiges Zepter erinnerte.
Amys hatte das Gesicht in ein Buch vergraben. Sie hatte laut daraus vorgelesen, und so schien es, als habe die Fahrt mindestens fünfzehn Stunden gedauert. »Die N1-Westumfahrung gehört zu einem Autobahnring um die Stadt und ist die am stärksten befahrene Straße Südafrikas«, trug Amy vor. »Wenn Sie sich dem Constitution Hill nähern, achten Sie auf den Hillbrow Tower, eines der größten Gebäude Südafrikas, das wie eine bescheidenere Version der Space Needle in Seattle wirkt.
»Äh … Amy? Hallo?«, versuchte Dan, sie zu stoppen. »Wir sind hier. Wir fahren über diese Straße und ich sehe auch den Tower.«
Amy beachtete ihn gar nicht. »Wir müssen die Ausfahrt Jan Smuts finden.«
»Ist das nicht einer von Nellies Liebhabern?«, alberte Dan.
Nellie beugte sich zu ihm und gab ihm eine Kopfnuss. »Ich bin Carlos treu. Und er findet auch diese Ausfahrt für uns.«
»Smuts war General und Premierminister Südafrikas«, erklärte Amy. »Er unterstützte die Apartheid, also die Rassentrennung. Aber 1948 sprach er sich dagegen aus und verlor prompt die Wahlen. Ist das zu glauben? Ich meine, dass die Afrikaner,
die schließlich zuerst hier waren, so behandelt wurden? Und man konnte nur Präsident sein, wenn man dem zustimmte!«
»Sie hätten die Bösen doch abwählen können«, meinte Dan. »So wie wir das in den USA machen. Na ja, wenigstens manchmal.«
»Wir haben da auch keine saubere Weste«, betonte Nellie. »Mein Vater Pedro Gomez wurde aus seiner Stadt vertrieben. Sie mochten es nicht, dass die Mexikaner auf der Straße herumstanden – dabei warteten sie nur auf Farmer, die sie für einen Tag als Arbeitskräfte anheuerten! Und meine Großmutter wollte sich im Süden ansiedeln, bis sie einmal zu einem Brunnen ging, und daran war tatsächlich ein Schild mit der Aufschrift ›Nur für Farbige‹ angebracht. Sie wusste nicht, ob sie nun farbig war oder nicht, aber allein die Tatsache, dass sie darüber nachdenken musste, ist doch abstoßend. Was glaubst du, warum es in den Fünfzigern und Sechzigern so viele Demos und Proteste gab?«
Dan erinnerte sich an die Bilder in seinen Geschichtsbüchern und den zahllosen Dokumentationen, bei denen Tante Beatrice immer eingeschlafen war. »Die Leute damals müssen verrückt gewesen sein«, erklärte er.
»Fürs Verrücktsein kann man nichts«, erwiderte Amy. »Aber das war alles geplant. In Südafrika gab es schon zu Kolonialzeiten Rassentrennung. Die Stammesangehörigen durften nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr in die weißen Städte. Sie mussten Ausweise bei sich tragen oder sie kamen ins Gefängnis. Aber offiziell begann die Apartheid erst in den Vierzigerjahren. Die Menschen wurden in Schwarze, Farbige, Weiße und Indischstämmige unterteilt. Farbig bedeutete, dass man halb schwarz und halb weiß aussah. Wer nicht weiß war, durfte auch nicht wählen. Und die Menschen mussten jeweils in gesonderten Gebieten
wohnen, ähnlich unseren Indianerreservaten, in sogenannten Homelands. Da gab es zwar eigene Schulen, Ärzte und so weiter – aber alles auf minderwertigem Niveau. Die Regierung erklärte die Homelands zu unabhängigen Staaten, damit
Weitere Kostenlose Bücher