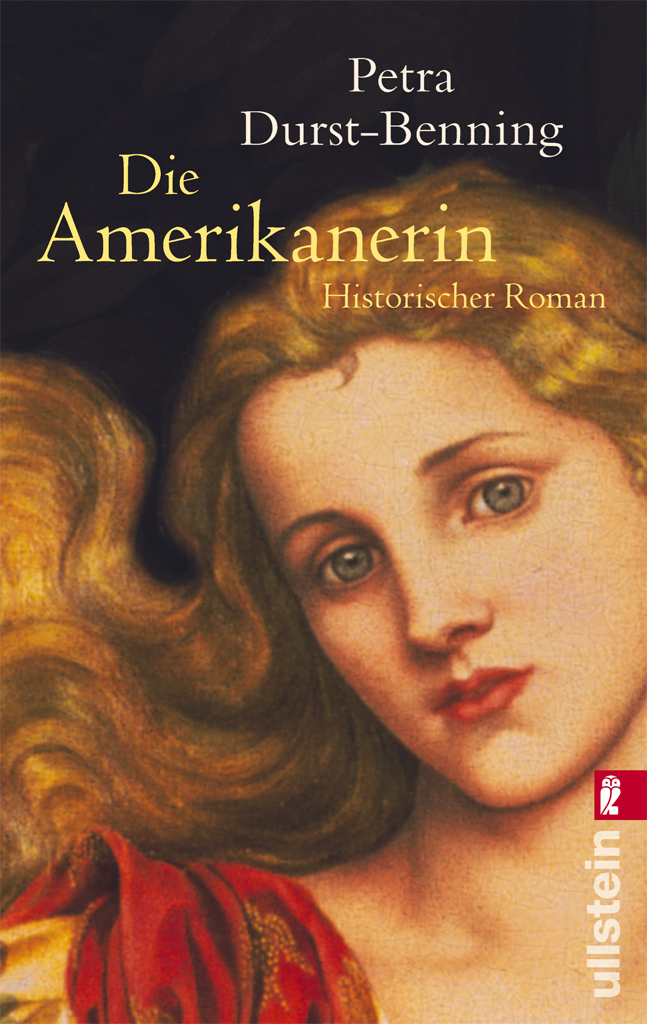![Die Amerikanerin]()
Die Amerikanerin
Sollten sich hier droben nur Künstler ansiedeln, wäre das wie ein Ghetto und der Kunst mehr als abträglich!«
»Und genau das glaube ich eben nicht. Es würde sich eine Reinheit der Kunst herauskristallisieren, die …«
Verwirrt schaute Marie von Pandora zu Sherlain. Worum um alles in der Welt ging es hier eigentlich?
»Mach dir nichts draus.« Susannas Atem kitzelte in ihrem rechten Ohr. Sie rutschte so nah heran, dass Marie ihren Unterarmgeruch wahrnehmen konnte. »Als ich in deinem Zustand war, habe ich meine Gedanken auch keine halbe Stunde beieinanderhalten können. Da war diese innere Unruhe … Und dann die überfallartige Übelkeit am Morgen! Es sind die Hormone, sagt man. Es soll übrigens Ärzte geben, die sich auf diese Art von Beschwerden spezialisiert haben.«
Wie Jagdhunde, die eine interessante Fährte witterten, hoben Sherlain und Pandora die Köpfe.
»Ein Arzt? In meinem Zustand – was meinst du damit?« Marie runzelte die Stirn.
Einen Moment lang schaute Susanna verwirrt drein, doch dann breitete sich ein vielsagendes Grinsen auf ihrem von der Sonne geröteten Gesicht aus.
»Also wirklich, Marie, uns gegenüber brauchst du doch nicht das Unschuldslamm zu spielen! Auf dem Monte wird soetwas ziemlich locker gesehen, das weißt du doch … Oder hast du Angst, du könntest eine von uns mit deiner Eröffnung schockieren?«
Susanna schien den Moment regelrecht zu genießen und schaute um Aufmerksamkeit heischend von Marie zu den beiden anderen Frauen hinüber. »Für wie dumm hält sie uns eigentlich?«
»Entschuldige, wenn ich schwer von Begriff bin, aber ich weiß immer noch nicht, was du von mir willst!«
Allmählich ging Marie Susannas geheimnisvolles Getue auf die Nerven. Diese zur Schau gestellte Abgeklärtheit – als ob sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hätte!
»Davon abgesehen, dass mir ein böser Traum ein wenig auf den Magen geschlagen ist und ich heute Morgen brechen musste, geht’s mir blendend. Und das gilt auch für meine Hormone!«, sagte sie und wälzte sich wieder auf den Bauch, um das Gespräch auf ihre Art zu beenden.
»Jetzt kapier ich erst …« Pandora stöhnte auf. »O nein! Kann es wahr sein? Marie, sag – bist du etwa … schwanger?!«
4
Zum wiederholten Male zog Harold die Taschenuhr, die an einer goldenen Kette baumelte, aus seiner Jackentasche. Wie immer, wenn der Deckel mit einem geschmeidigen Klack aufsprang, machte sein Herz einen kleinen Hüpfer. Schon als Junge hatte er sich nach einer Taschenuhr gesehnt, und nun hatte er sogar eine goldene. Er strich einen imaginären Fussel vom gewölbten Uhrenglas, bevor er sie wieder zuklappte. Nie würde er wie einige seiner Kollegen die neue Mode mitmachen, eine Uhr am Handgelenk zu tragen!
Stirnrunzelnd schaute er zur Tür.
Wo blieb Wanda nur? Sie waren um acht Uhr verabredetgewesen, und nun war es zwanzig nach. Ich hätte darauf bestehen sollen, sie von zu Hause abzuholen, dachte er ärgerlich. Zumindest hätte er sich dann keine Sorgen um ihr Wohlergehen machen müssen.
Der befrackte Kellner, der in der Nähe seines Tisches herumstrich, seit Harold sich gesetzt hatte, machte einen Schritt auf ihn zu.
»Möchte Monsieur vielleicht schon einen Wein wählen? Oder darf ich die Karte vorlegen?«
»Nein, danke. Ich warte auf meine Begleitung.«
»Darf ich Monsieur einen Aperitif bringen?«
»Nein«, versetzte Harold leicht gereizt. Hoffentlich würde sich die Wahl des Restaurants nicht als Fehler herausstellen – gerade heute Abend war ihm der äußere Rahmen wichtig. Unwillkürlich wanderte seine rechte Hand zur Brusttasche seines Jacketts. Das lederne Etui fühlte sich kühl und glatt an.
Der Kellner zögerte noch einen Moment, trat dann aber zurück und stellte sich drei Schritte von Harolds Tisch entfernt mit hinter dem Rücken verschränkten Händen auf.
Harold nippte an seinem Wasserglas.
Natürlich hätten sie sich auch bei Mickey in der Brooklyn Bar treffen können. Oder in einem der italienischen Restaurants, die sie sonst gern frequentierten. Doch Bier und Spaghetti wären Harold zu gewöhnlich gewesen – ein französisches Feinschmeckerlokal schien ihm dagegen dem Anlass angemessen. Außerdem gab es hier weder deutsche Bratwürste noch deutsche Knödel. Es wurde weder deutsch gesprochen noch gesungen. Es hingen auch keine deutschen Fahnen an den Wänden, und der Kellner, so aufdringlich er auch sein mochte, trug keine deutsche Tracht. Und das war gut so!
Während er die Tür
Weitere Kostenlose Bücher