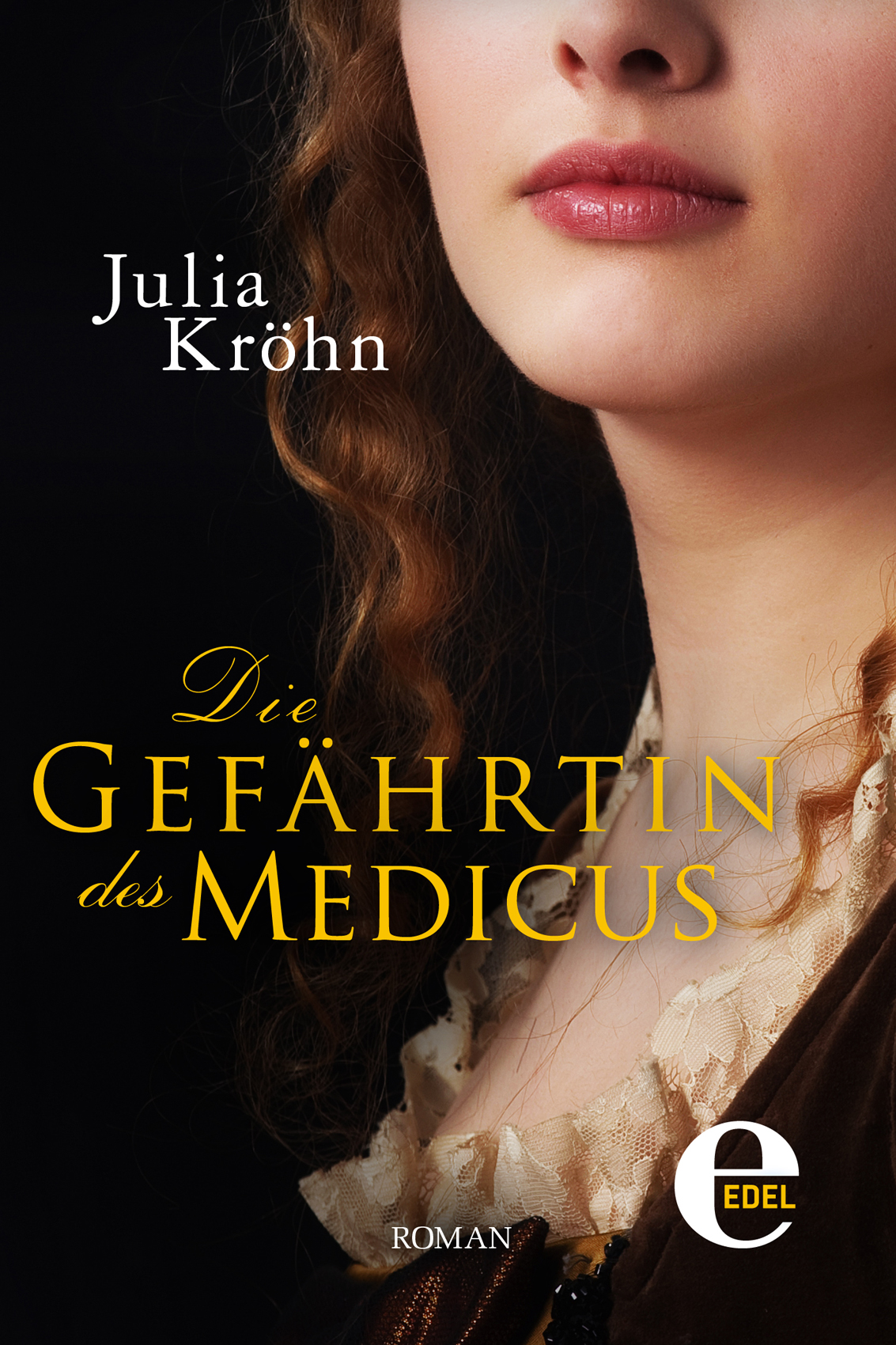![Die Gefährtin des Medicus]()
Die Gefährtin des Medicus
Schiffsforum, wo sich der Hauptmast befand – und stieß immer wieder auf Grenzen aus dunklem Wasser, weißer Gischt, scharfer Luft und blauem Himmel – und das nicht nur für wenige Augenblicke, sondern mehrere Tage lang. Fremd und neu war zunächst alles auf dem Schiff gewesen, doch nachdem sie sämtliche Winkel erforscht hatte, wurde es kleiner und kleiner – und mit ihm schien sie selbst inmitten einer riesigen und zugleich unbesiedelten Welt zu schrumpfen. Gott mochte an fruchtbarer Erde gespart und es zum Los des Menschen gemacht haben, das Wenige, das blieb, mit Schweiß zu beackern. Doch beim Wasser war er verschwenderisch gewesen. In Saint – Marthe hatte Alaïs oft die Grenze des Horizonts fixiert, bis ihr die Augen tränten, und sich die Welt ausgemalt, die dahinter läge. Nun erkannte sie, dass das Besondere am Reisen nicht das Erforschen eines fremden Landes war, sondern das mögliche Fehlen eines solchen. Es war die ebenso erregende wie nagende Furcht, es gäbe nur mehr dieses Schiff und diese Menschen und sonst nichts, außer abgrundtiefes Wasser.
So also schmeckte die Essenz von Freiheit. So salzig, so schnittig, so wackelig, so schwindlig, so eintönig, so bläulich. Ihre Melodie war schlicht. In Ufernähe hatten noch kreischende Möwen das Schiff umkreist, doch irgendwann blieben sie fern. Neben den Geräuschen des Schiffs gab es nichts zu hören als den heiseren Chor der aufspritzenden Wellen und des röhrenden Windes.
Oft stand sie allein im Schiffsforum. Bianca mied das Freie, Aurel auch, nur Simeon gesellte sich manchmal zu ihr, und wenn er nicht schwieg oder über die Natur des Menschen sprach, beantwortete er die vielen Fragen, die sie stellte.
Warum das Schiff des Nachts mehr Tempo zulegte als des Tags. Woher kundige Matrosen das Wissen nahmen, am Geschmack des Wassers ihre Position ablesen zu können. Warum sie manchmal gegen eine Flaute anruderten, manchmal nicht.
Umgekehrt fragte er nichts, wollte nicht wissen, woher sie kam und was sie auf das Schiff trieb. Er ersparte ihr das Geständnis, dass sie nicht nur vor der Heimat floh, sondern vor Mann und Tochter, dass sie freiwillig auf die Familie verzichtete, die man ihm grausam geraubt hatte.
Sie überlegte, ob es daran lag, weil ihm die Neugierde fehlte – oder weil er keiner erklärenden Worte bedurfte, um sie zu durchschauen, nur ihrer Miene. »Was verrät dir mein Gesicht über mich?«, fragte sie einmal unverhohlen.
Er zuckte die Schultern. »Es gibt Menschen, die stehen ruhig, und es gibt Menschen, die laufen«, meinte er nach einer Weile. »Ich gehöre zu Letzteren, weil ich es muss, und du gehörst zu Letzteren, weil du es willst. Aber ich weiß nicht, ob Müssen und Wollen so weit auseinanderliegen.«
Alaïs schwieg. Wie so oft, wenn Simeon etwas sagte, vermeinte sie, dass es überaus klug und bezeichnend wäre, würde sie es nur ergründen können. Aber dies hätte erfordert, seine Worte immer und immer wieder zu wiederholen, sie von allen Seiten zu betrachten; ja, sie vorerst festhalten zu müssen. In jener windigen, bodenlosen Weite widersprach das jedoch nicht nur ihrer Natur, sondern dem Gesetz, dass hier nur glücklich werden konnte, wer sich nicht umdrehte und an Vertrautes krallte.
Sie sah Aurel in den ersten Tagen selten. Während sie entweder Zeit bei Bianca verbrachte oder aber das Schiff erforschte, hockte er in jenem Raum, den Pio Navale als seine Bibliothek eingerichtet hatte und wo er seinen Geist mit Schriften sättigte. Er las etwa im
Compendium Medicinae,
das Gilbertus Anglicus aufgeschrieben hatte, der wiederum ein Leibarzt des englischen Königs gewesen war. Mochte Navale zwar in Marseille bekundet haben, dass ihm irgendwann die neuen Bücher ausgegangen wären, so hatte er es doch nicht übers Herz gebracht, die alten in der Heimat zurückzulassen.
Nicht nur Aurel, sondern auch Navale selbst hielt sich häufig dort auf, wie sie nach einigen Tagen herausfand. Da geschah es nämlich, dass er sie zu sich rufen ließ.
Sie hatte erwartet, dass auch Aurel zugegen wäre, doch stattdessen traf sie ihn allein an. In dem stickigen Raum roch es salzig wie überall und zugleich staubig, als würden sich zwischen all den meist kunstvoll mit Leder eingefassten Buchdeckeln nicht nur Pergamentseiten befinden, sondern auch der Dreck und Staub von Jahrzehnten.
Etwas unsicher blickte sie auf Giacintos Bruder. Nie war sie bisher allein mit ihm gewesen, und jener merkwürdig weiße Blick war ihr unheimlich. Doch
Weitere Kostenlose Bücher