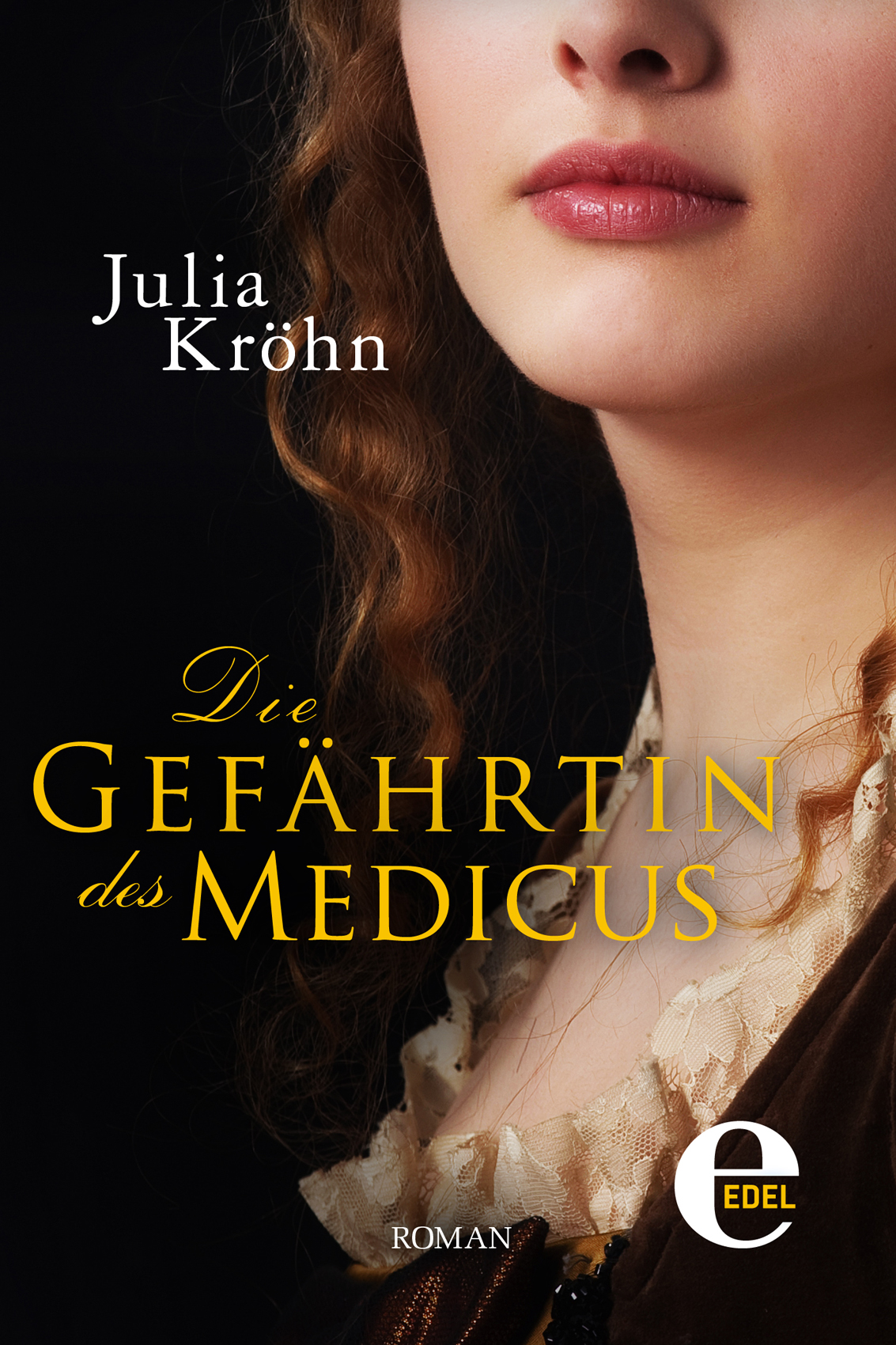![Die Gefährtin des Medicus]()
Die Gefährtin des Medicus
beantworten können, Trauer mit eigener Verzweiflung, Strenge mit Stärke.
Doch nichts dergleichen kam von ihm, und so fiel ihr Bekenntnis äußerst schlicht aus, fast tonlos.
»Ich will frei sein«, sagte sie.
Er nickte verspätet, als erreichten ihre Worte ihn erst nach einer Weile. Kein überraschter Aufschrei ertönte aus seinem Mund, kein Runzeln zerfurchte seine Stirn. Er nickte, nickte immer wieder, wandte sich dann ab, als gäbe es nichts zu sagen – und dann, im letzten Augenblick, als sie tatsächlich befürchtete, er könnte sie einfach so stehen lassen, da fuhr er herum und knurrte: »Und was willst du dann von Aurel Autard?«
Da war er – jener Vorwurf, gegen den sie sich gerüstet hatte und der nun nichts damit zu tun hatte, dass sie ihr Bündel geschnürt und einen schlafenden Emy, eine schlafende Raymonda, ohne jede Erklärung zurückgelassen hatte.
»Wenn du wirklich frei sein willst, Alaïs, dann laufe der Freiheit nach, nicht ihm«, setzte er hinzu.
Sie war verwirrt. »Aber er ist es doch, der mir die Freiheit schenkt!«, begehrte sie auf. »Ich kenne keinen anderen Menschen, der sich so gegen jegliche Fessel sträubt wie er.«
Wieder nickte Ray, aber diesmal mit hängenden Schultern. Er hatte seinen Kummer um Caterina fast nie gezeigt, doch nun fühlte sie, wie Traurigkeit sich um ihn ausbreitete wie eine dunkle Wolke. Vielleicht ward sie nicht nur vom Verlust eines geliebten Menschen gezeugt, vielleicht rührte sie noch viel tiefer, an jene Melancholie, die sie schon in ihren Kindertagen manchmal hatte aufblitzen sehen. Meist lachte er darüber hinweg. Doch jetzt – jetzt lachte er nicht. »Gegen seine Fesseln wehrt er sich. Nicht gegen die deinen. Die musst du selbst durchtrennen.«
Sie presste ihr Bündel an sich, hielt sich daran ebenso fest wie an dem Trotz, der sie davor bewahrte zu erschaudern. »Ich dachte, du würdest mich als Einziger verstehen.«
»Und ich verstehe dich auch«, sagte er. Er trat ganz dicht zu ihr, packte sie an den Schultern, zwang sie, ihm ins Gesieht zu sehen. Er war ihr fremd, weil er so ernst war und so nah, weil da plötzlich etwas in seinen Augen stand, was sie selbst an sich kannte: nicht mehr nur Trauer und schmerzliche Sehnsucht, sondern Hader ob vergeudeter Gelegenheiten. »Ja, ich verstehe dich«, bekräftigte er. »Aber ich will, dass du begreifst, was dich treibt und warum. Lauf ihm nicht blind nach und vor allem nicht ihm allein. Das, was du dir ertrotzt, soll dir gehören, nur dir – nicht ihm geopfert sein.«
Ihre Kehle wurde eng. Sie blinzelte die Tränen weg. »Hat jemals etwas dir allein gehört, Vater? Du warst doch nie ein freier Mann. Es war doch immer Mutter da …«
Er schüttelte den Kopf. »Ganz am Anfang nicht. Es gab eine Zeit, da lebte ich für mich und sonst für niemanden. Ein Teil von mir hat’s sehr genossen. Ein Teil von mir hat sich immer danach zurückgesehnt. Vielleicht ist’s dieses Erbe, an dem du schleppst.«
Er sprach von Last, und obwohl sie sich gerade noch so leicht gefühlt hatte, ahnte sie, was er meinte. Sie schüttelte sich wie ein nasser Hund.
»Wenn du dich heimlich nach Freiheit verzehrtest«, murmelte sie, »hast du dir dann nie überlegt, Mutter und uns Kinder einfach zu verlassen?«
Ernst und ausdruckslos war sein Gesicht bis jetzt gewesen, nun lächelte er wehmütig. Wenn er jemals – unverstellt von Spott und Leichtfertigkeit – bekundete, wie sehr Caterina ihm fehlte, so war es in diesem Augenblick. »Ich hätte es vielleicht getan … wenn ich mir jemals vollends sicher gewesen wäre, dass sie mich liebt.«
»Du denkst, es war nicht so?«, fragte sie verwirrt. Sie hatte den strengen, nörgelnden Tonfall im Ohr, mit dem Caterina oft auf den neckischen des Vaters geantwortet hatte, aber sie erinnerte sich ebenso gut an jenes Gefühl von Geborgenheit und Wärme, das sich nur bei zwei Menschen erleben lässt, die einander nahestehen und einander trauen.
»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich kenne kaum ein anderes Paar, das derart zusammengehört wie wir. Und doch, vor vielen, vielen Jahren, da habe ich deiner Mutter etwas angetan … nein, nicht ich selbst. Jedoch trage ich die Schuld, dass sie in eine … bestimmte Lage geriet. Es waren meine Dummheit und mein Eigensinn. Und bis zu dem Augenblick, da sie starb, war ich mir nicht sicher, ob sie mir wirklich verziehen hat. Womöglich war ein Großteil ihres Herzens mit mir versöhnt – doch nicht das ganze.«
»Und deswegen bist du immer
Weitere Kostenlose Bücher