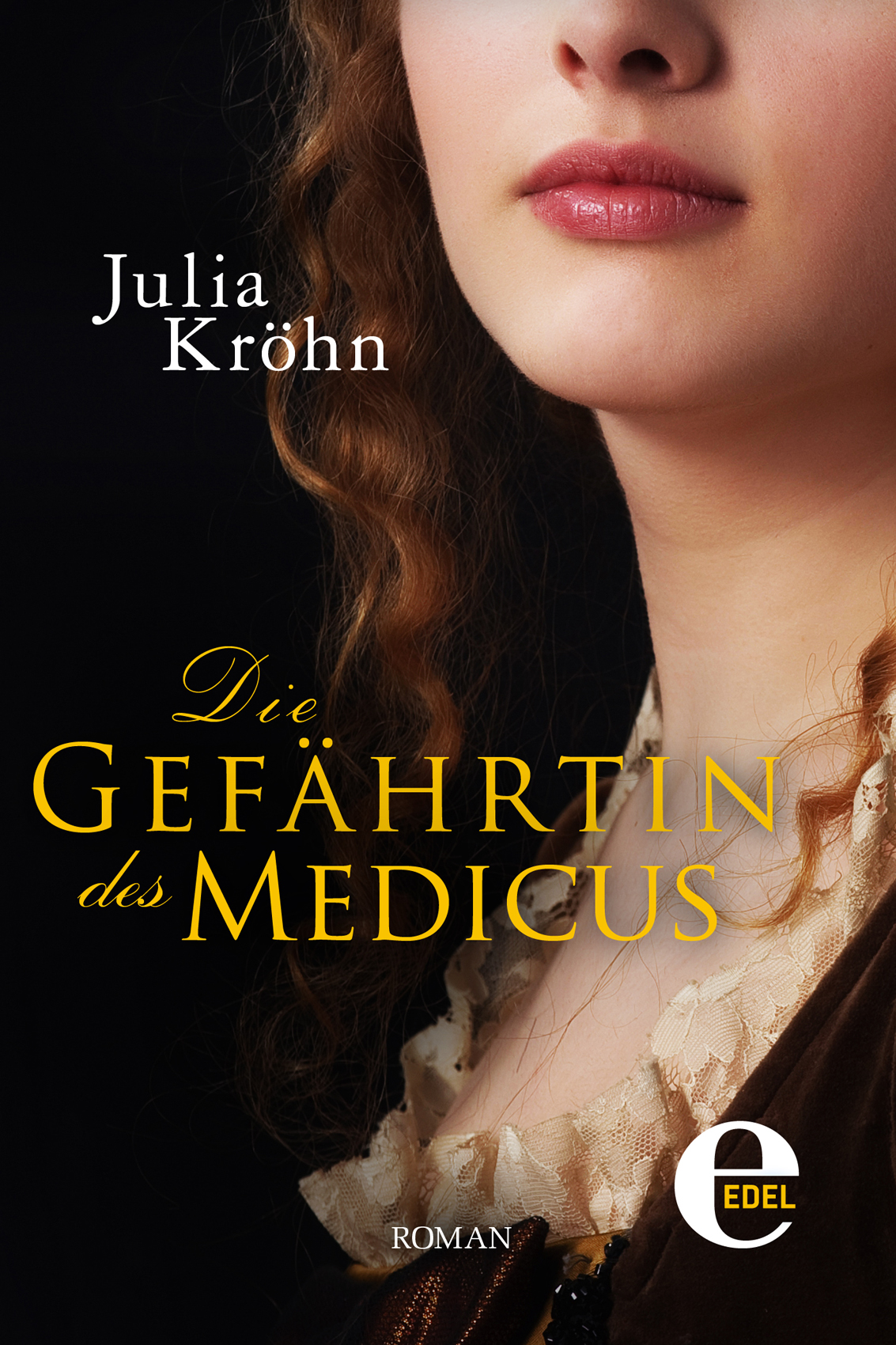![Die Gefährtin des Medicus]()
Die Gefährtin des Medicus
küsste, immer wieder küsste. Eigentlich fühlte es sich nicht an, als würde er sie küssen, eigentlich fraß er sie auf, nicht nur die dünne Haut, sondern alles, was darunter lag. Das Einzige, was er ihr nicht nahm, als er in ihren Körper stieß, war das Kribbeln in ihrer Leibesmitte, das stärker wurde, sich zu verkrampfen schien – bis es plötzlich zersprang.
Auch als es zu Ende war, löste sich sein Körper nicht von ihrem. Dicht blieben sie aufeinandergepresst, rutschten auf dem sandigen Grund nur ein wenig höher, damit die nächtlichen Wellen ihre Füße nicht mehr erhaschten.
»Du bist ein Prachtweib!«, sagte Sancho wieder, ehe er einschlief.
Die nächsten drei Tage vergingen wie in einem Rausch. Aläis wusste später nicht mehr, was sie mit Sancho geredet hatte. Ob sie überhaupt mit jemand anderem gesprochen hatte, vielleicht mit dem leidenden Aurel, konnte sie nicht sagen. Sie erinnertesich nur an Empfindungen, an den betörenden Duft von Resedabüscheln und Orangenblüten, an das kalte, salzige Wasser der kleinen Buchten, zu denen Sancho sie führte, an den Sand, der an ihrer Haut klebte und schmerzhaft scheuerte, wenn sich ihre auf seiner rieb. Vielleicht gab es auf der Insel noch so viel mehr als schroffe Felsen, auf denen sich Büsche und widerstandsfähige Bäume festhielten, so viel mehr als Sand und Meer – aber ihre Welt bestand in jenen Tagen aus nichts anderem, und diese Welt passte zu der Leidenschaft, die zwischen ihr und Sancho loderte. Nie war sie sauber, immer klebte irgendwo Sand oder verkrustetes Salz. Nie lag sie richtig bequem, immer spritzte irgendwo kaltes Wasser oder schnitt sich manch rauer Zweig in ihre Fußsohle. Nie war sie so frisch gewesen, so wach, so überdreht. Nie hatte sie gedacht, es wäre so leicht, auf Essen zu verzichten, auf frische Kleidung, auf ein Bett. Ja, die Liebe mit Sancho stach und brannte und scheuerte, sie riss ihre Haut auf und ihre Kleider in Fetzen, sie erzeugte Kratzspuren und blaue Flecken, und all das schmeckte nach Leben, nach frischem und reichlichem Leben, keines, das man sich mühsam aufsparen musste.
Was sie an den Tagen getrieben hatten – sie wusste es später nicht mehr. Aber die Nächte gehörten ihr, und Sanchos Leib gehörte ihr, erfüllend, schmerzlich, rau, zärtlich. Ob sie gelacht hatte, weil er Spaße machte oder weil er sie hinter den Ohrläppchen kitzelte?
Auch dessen war sie sich später nicht sicher, vermeinte nur, dass sich die vielen Laute zwischen ihnen – das Girren und das Stöhnen und das Seufzen und das Hauchen – nur selten in menschliche Worte gekleidet hatten. Dieser bedurften sie nicht. Die Laute waren gerne nackt – so wie sie, wenn sie zwischendurch im dunklen Meereswasser badeten, bevor sie die Umarmung suchten oder danach. Sie ruhten sich selten in den Armen des anderen aus, sondern sprangen alsbald wieder auf, auf dass sie das aufregende Spiel erneut aufnehmen konnten, bestehend aus Liebkosungen und Umarmungen und Tänzen und Raufereien. Lustvoll war dies alles bei Sancho und ebenso schmerzhaft. Später hatte sie das Gefühl, sie hätten sich ebenso häufig an den Haaren gerissen wie geliebt, sich in den Leib geboxt, sich am Hals gewürgt, sich gebissen und gekratzt. Mochte ihre Gier vieles sein, sättigend und hungrig zugleich, ungezähmt und ungeduldig, hitzig und nass – lieblich war sie ganz sicher nicht.
Ebenso kantig ragte plötzlich ein Moment der Nüchternheit in jene Trunkenheit. Während sie sich in den ersten Nächten nicht an der Kälte gestört hatten, reichte es Sancho plötzlich nicht mehr, sich an ihrem Leib zu wärmen. Sie musste eingeschlafen sein, und als sie erwachte, hörte sie, wie ein Feuer knisterte.
Er saß davor, hatte Steine darum geschichtet und nährte es mit morschem Holz. Es knackte und sprühte Funken. Er ließ sich nicht anmerken, ob einige davon schmerzhaft seine Haut trafen. Alaïs erhob sich. Wohliges Zittern überrann immer noch ihren Körper, und zugleich fühlte sie sich wund und steif an. Sie trat zum Feuer, hockte sich neben ihn, und als Alaïs in sein Gesicht starrte, hatte sie das Gefühl, es hätte sich verändert, war nicht mehr nur lüstern und spöttisch wie bisher, sondern auch nachdenklich. Sie lehnte sich an ihn, hoffte, damit jene Vertrautheit, jene Eingespieltheit ihrer Leiber heraufzubeschwören, die jedes Wort unwichtig machte.
Doch die Zeit des Schweigens war vorüber.
»Ich will nicht so leben wie Gaspare und Akil«, begann er heiser zu
Weitere Kostenlose Bücher