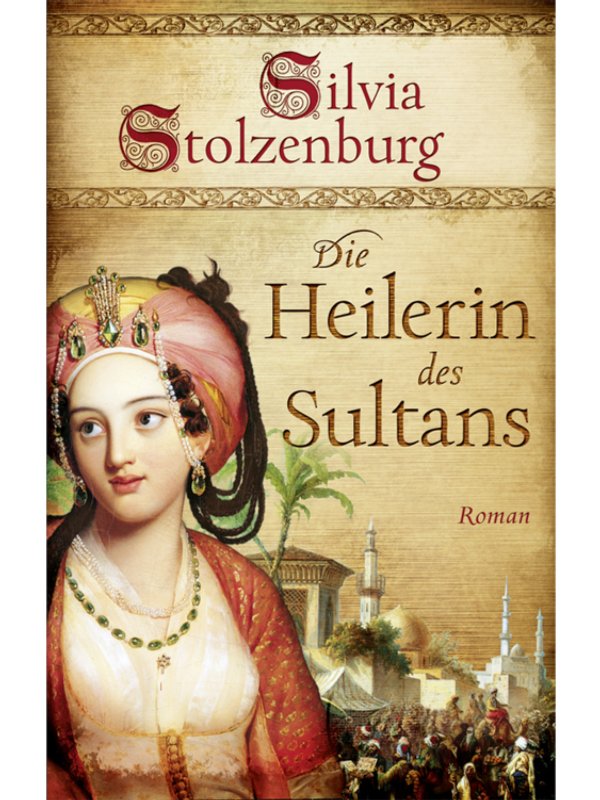![Die Heilerin des Sultans]()
Die Heilerin des Sultans
einem kurzen Nicken von ihm abgewandt. Kaum
klammerten sich ihre Finger um das kühle Leder, verpuffte der
Reiz des Marktes und sie machte sich schnurstracks auf den Weg ins Darüssifa, um
der Tabibe ihren
Schatz zu zeigen. Zweifelsohne würde auch diese begeistert sein
von der bildlichen Darstellung von Schnitten während der Geburt,
Urinfarben und den genauen Mischungsverhältnissen von
schmerzlindernden Mitteln.
Ohne
auf die Schicklichkeit zu achten, flog sie an Hofdamen und Wächtern
vorbei in den innersten Bereich des Palastes, der seit der
Abwesenheit Bayezids ausgestorben und leblos wirkte. Der Wunsch nach
der Nähe des Padischahs hatte sich in den vergangenen
Tagen wieder verstärkt, aber sie hatte gelernt, das Gefühl
in Schach zu halten. Dennoch verspürte sie ein Zwicken des
Bedauerns, als sie unter den Fenstern seiner Zimmerflucht vorbei ins
Hospital stürmte, wo sie von einer ungewohnten Stille empfangen
wurde. Seit dem Abzug der Truppen, lag der Flügel der
Janitscharen beinahe vollkommen verwaist da, und auch die Leiden der
Frauen schienen weniger geworden zu sein. Mit wehender Entari hastete sie auf den hinteren
Teil des Krankenhauses zu, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne,
als ihr der durchdringende, metallische Geruch von Blut in die Nase
stach. Unheil verkündend hing er in der Luft und schlug sich in
ihrem Rachenraum nieder, sodass sie den Eindruck hatte, ihn zu
schmecken. Die Tür, welche ins Reich der Ebe
– der Hebamme –
führte, stand eine Handbreit weit offen; und zusammen mit der
deutlich spürbaren Anspannung verriet diese Nachlässigkeit
Sapphira, dass sich dahinter ein Drama abgespielt haben musste.
Unsicher verharrte sie einen Moment auf der Schwelle und lauschte auf
die Geräusche, die aus der Kammer drangen. Verhaltenes Flüstern
wechselte sich mit dem Klirren von Metall und dem Plätschern von
Wasser ab, doch kein Laut verriet die ansonsten übliche Hektik.
Mit einem Engegefühl im Hals drückte sie die Tür auf
und erstarrte, als sie die blutigen Stofffetzen sah, die achtlos über
eine der hölzernen Trennwände geworfen worden waren. Das
Glück über den Kauf vergessen, umrundete sie den bemalten
Wandschirm – und blieb wie angewurzelt stehen, als ihr Blick
auf den halb nackten Leib einer jungen Frau fiel. In seiner
wächsernen Bleichheit bildete dieser einen beinahe unwirklichen
Kontrast zu den blutgetränkten Laken, auf denen er ruhte.
Umringt wurde die Tote von der Ebe, der Tabibe und zwei Helferinnen, die
alle auf ein winziges Gebilde starrten, das reglos und besudelt
zwischen den Beinen der Verstorbenen lag. Zwei weitere Cariyesi säuberten die Frau mit
feuchten Schwämmen, die sich schneller mit ihrem Blut vollsogen,
als diese sie auswringen konnten. »Ach, Sapphira«,
seufzte die Tabibe, die
das Eintreten des Mädchens bemerkt hatte. »Wenn sie doch
nur ein wenig früher gekommen wäre, dann hätten wir
sie retten können!« Erschüttert verfolgte das
Mädchen, wie eine der jungen Frauen die Fehlgeburt aufhob, in
ein sauberes Tuch einwickelte und behutsam auf ein Kissen bettete.
Traurigkeit breitete sich in ihr aus. Warum konnte eine solche
Verschwendung von Leben nicht verhindert werden? Warum gelang es dem
Tod immer wieder, der Heilkunst ein Schnippchen zu schlagen?
Kapitel 35
Das
Mittelmeer, Sommer 1400
Mit einem
flauen Gefühl in der Magengegend verfolgte Otto das Gemetzel auf
See. Da eine der Koggen lichterloh in Flammen stand, war es nicht
schwer, die grausigen Einzelheiten des Schlachtens auszumachen.
Überall trieben tote und verstümmelte Körper im
Wasser, das rot war vom Schein des Feuers und dem Blut der
Erschlagenen. Das Geräusch auftreffender Armbrustbolzen
vermischte sich mit dem Klirren von Schwertern, doch die Venezianer
waren den kampferprobten Piraten nicht gewachsen. Weil nicht alle
Mitglieder des Handelszuges in den Betrug des Kapitäns
eingeweiht worden waren, mussten diejenigen, die sich zur Wehr
setzten, in der geschickt gestellten Falle ihr Leben lassen –
sollte der Streich vom Senat ungeahndet bleiben. Umringt von dem
listigen Schiffsführer und seinen Kameraden, stand Otto am
Strand der kleinen Insel, bei der es sich zweifelsohne um einen
Unterschlupf der Seeräuber handelte. »Nun, was sagt Ihr?«,
riss ihn der Italiener aus den Gedanken. »Ihr seid Euren Neffen
los und ich die mangelhafte Ware.« Er stieß mit dem Fuß
gegen einen prall gefüllten Sack zu seinen Füßen, der
ein gedämpftes Klimpern von sich gab.
Weitere Kostenlose Bücher