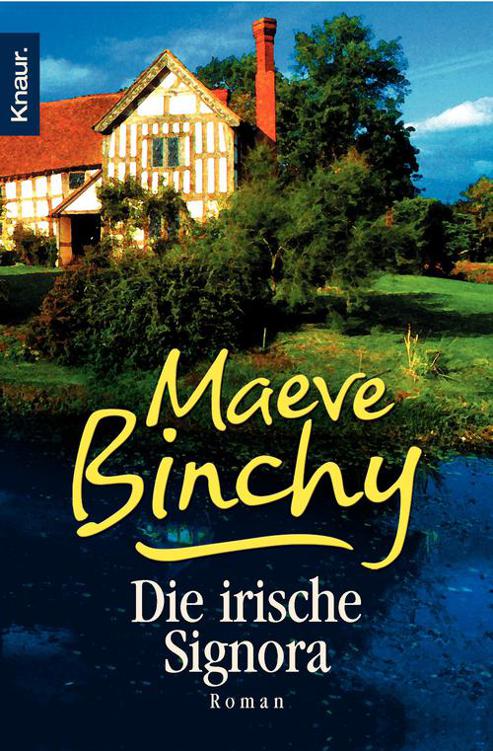![Die irische Signora]()
Die irische Signora
Grania, während sie Lidschatten auftrug. Da kam ihre Mutter herein. »Hey, Mam, beeil dich, wir wollen in ein paar Minuten aufbrechen«, meinte Grania.
»Ich bin fertig.«
Sie schauten ihre Mutter an – das Haar kaum gekämmt, ungeschminkt, ein gewöhnliches Kleid, eine Strickjacke lose um die Schultern gelegt. Es hatte keinen Zweck, etwas zu sagen. Die Schwestern tauschten einen Blick und enthielten sich jeglichen Kommentars.
»Na gut«, sagte Grania. »Dann gehen wir.«
Es war das erstemal seit dem Krankenhausaufenthalt, daß Nessa Healy ausging. Und die Farbberaterin hatte ihr einige sehr gute Tips gegeben.
Barry fand, daß seine Mutter seit Jahren nicht mehr so gut ausgesehen hatte. Zweifellos hatte Fiona einen wunderbaren Einfluß auf sie ausgeübt. Sollte er Fiona fragen, ob sie ihn bei der
viaggio
begleiten wollte? Das war ein Schritt von großer Tragweite, denn es würde beispielsweise bedeuten, daß sie sich ein Zimmer teilten. Und in dieser Hinsicht waren sie in den Wochen, seit sie sich kannten, nicht sehr weit fortgeschritten. Er wollte es zwar, aber bisher hatte sich nie eine günstige Gelegenheit ergeben, es war immer der falsche Ort oder der falsche Zeitpunkt.
Sein Vater schaute unbehaglich drein. »Was werden das denn für Leute sein, mein Sohn?«
»Alle Kursteilnehmer und diejenigen, die sie mitschleppen konnten, so wie ich dich mitschleppe. Es wird klasse, Dad, ganz bestimmt.«
»Ja, das glaube ich gern.«
»Außerdem, Dad, hat Miss Clarke gesagt, daß ich mit dem Lieferwagen vom Supermarkt hinfahren kann, auch wenn es eigentlich eine Privatfahrt ist. Wenn du oder Mam euch langweilt oder müde seid, kann ich euch jederzeit heimbringen.«
Er war so voller Vorfreude und Dankbarkeit, daß sein Vater sich beschämt fühlte. »Hat Dan Healy etwa jemals eine Party verlassen, solange es noch etwas zu trinken gab?« meinte er.
»Und Fiona treffen wir erst dort?« Mrs. Healy wäre froh gewesen über die moralische Unterstützung dieses aufgeweckten jungen Mädchens, das sie mittlerweile sehr ins Herz geschlossen hatte. Fiona hatte ihr das Versprechen abgerungen, die große Konfrontation mit Nell noch zu verschieben. Eine Woche, nur eine einzige Woche, hatte sie gebeten. Und widerstrebend hatte Nessa Healy nachgegeben.
»Ja, sie hat nachdrücklich darauf bestanden, allein hinzufahren«, antwortete Barry. »Also, machen wir uns auf den Weg?«
Und das taten sie.
Die Signora stand in der Aula.
Ehe sie vom Haus der Sullivans aufgebrochen war, hatte sie sich in dem langen Spiegel betrachtet. Tatsächlich erkannte sie die Frau kaum wieder, die vor einem Jahr nach Irland gekommen war. Damals hatte sie sich als Witwe gefühlt, die um ihren toten Mario trauerte. Sie erinnerte sich an ihr langes, wehendes Haar und den langen Rock, der ungleichmäßig fiel. Und sie war so schüchtern gewesen, hatte es kaum geschafft, sich eine Arbeit oder eine Wohnung zu suchen, und fürchtete sich vor dem Wiedersehen mit ihrer Familie.
Heute stand sie hier, groß und elegant in ihrem kaffeebraunen und lilafarbenen Kleid, das perfekt zu ihrer merkwürdigen Haarfarbe paßte. Suzi hatte gemeint, dieses Kleid könne gut und gern dreihundert Pfund gekostet haben. Unglaublich!
»Mich beachtet doch sowieso niemand«, hatte sie eingewandt, während sie sich von Suzi schminken ließ.
»Das ist Ihr großer Abend, Signora«, hatte Peggy Sullivan unbeirrt erwidert.
Und sie behielt recht. Die Signora stand in der Halle, umgeben von bunten, blinkenden Lichtern, mit Bildern und Plakaten ringsum, und die Musikanlage spielte ein Endlosband mit italienischen Liedern, bis die Live-Gruppe mit einem Tusch beginnen würde. Man hatte beschlossen, daß
Nessun dorma
,
Volare
und
Arrivederci Roma
mehrmals vom Band gespielt werden sollte. Nichts allzu Unbekanntes.
Aidan Dunne kam herein. »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen jemals danken kann«, sagte er.
»Ich bin es, die sich bei Ihnen bedanken muß, Aidan.« Er war der einzige, dessen Name nicht italienisiert worden war. Dadurch wurde seine besondere Rolle noch unterstrichen.
»Sind Sie aufgeregt?« fragte er.
»Ein bißchen. Andererseits sind wir ja von lauter Freunden umgeben, warum sollte ich da aufgeregt sein? Alle stehen auf unserer Seite, keiner ist gegen uns.« Sie lächelte und verscheuchte den Gedanken, daß heute abend niemand von ihrer eigenen Familie kommen und ihr Unterstützung geben würde. Sie hatte sie freundlich darum gebeten, doch nicht gebettelt. Wie schön
Weitere Kostenlose Bücher