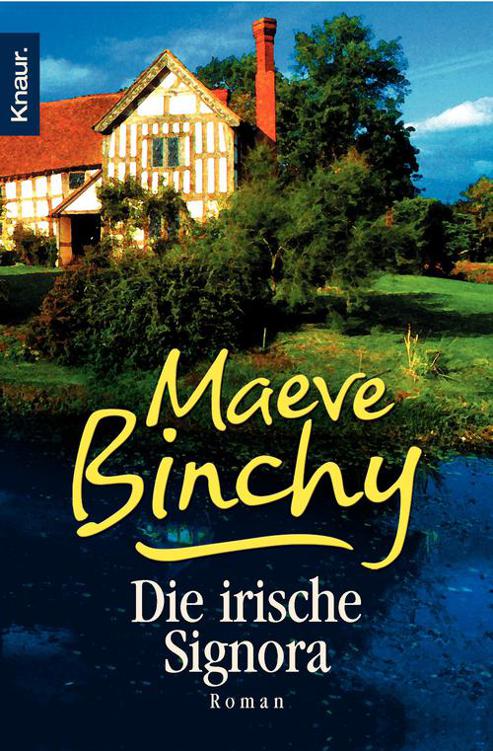![Die irische Signora]()
Die irische Signora
Bus gestiegen war; dank Marios Beschreibungen hatte sie das kleine Hotel seines Vaters sofort erkannt. Marios Gesichtsausdruck war so hart gewesen, daß sie jetzt noch beim Gedanken daran erschauerte. Er hatte wortlos auf einen Lieferwagen vor dem Haus gedeutet und sie hineingedrängt. Dann war er losgebraust, hatte in halsbrecherischem Tempo die Kurven geschnitten und war unvermittelt von der Straße abgebogen, hinein in ein abgeschiedenes Olivenwäldchen, wo niemand sie sehen konnte. Sie hatte ihm voller Verlangen die Arme entgegengestreckt, mit all der Sehnsucht, die ihre ständige Begleiterin auf dieser Reise gewesen war.
Aber Mario hatte sie weggestoßen und auf das Tal gezeigt, das sich zu ihren Füßen erstreckte.
»Sieh diese Weinberge, die gehören Gabriellas Vater. Sieh jene dort, die gehören meinem. Es war uns von Anfang an bestimmt zu heiraten. Du hast kein Recht, einfach hierherzukommen und mich in Schwierigkeiten zu bringen.«
»Ich habe alles Recht der Welt. Denn ich liebe dich, und du liebst mich.« So einfach war es.
In seinem Gesicht machte sich Bestürzung breit. »Du kannst nicht behaupten, daß ich nicht ehrlich gewesen bin. Ich habe es dir gesagt, ich habe es deinen Eltern gesagt. Nie habe ich so getan, als ob ich frei und nicht Gabriella versprochen wäre.«
»Im Bett hast du nichts davon gesagt. Da hast du keine Gabriella erwähnt«, wandte sie ein.
»Keiner erwähnt im Bett eine andere Frau, Nora. Sei vernünftig, fahr wieder nach Hause, kehr zurück nach Irland.«
»Ich kann nicht zurück«, antwortete Nora schlicht. »Ich muß dort sein, wo du bist. So ist es nun einmal. Ich werde für immer hierbleiben.«
Und so war es.
Jahr um Jahr verstrich, und allein durch ihre Beharrlichkeit wurde die Signora Teil des Lebens von Annunziata. Nicht, daß man sie wirklich in die Dorfgemeinschaft aufgenommen hätte, denn man rätselte immer noch darüber, was sie eigentlich hier wollte; ihre Erklärung, sie liebe Italien, erschien ziemlich dürftig. Sie bewohnte zwei Zimmer in einem Haus am Dorfplatz. Und weil sie sich ein bißchen um das ältliche Ehepaar kümmerte, dem das Haus gehörte, ihnen morgens dampfende Tassen mit
caffè latte
brachte und die Einkäufe für sie erledigte, zahlte sie nur eine geringe Miete.
Doch sie war kein Störenfried. Weder schlief sie mit den Männern, noch trank sie in Bars. Jeden Freitagvormittag gab sie in der kleinen Schule Englischunterricht. Und sie nähte kleine Liebhaberstücke, die sie alle paar Monate zusammenpackte und in einer größeren Stadt verkaufte.
Italienisch lernte sie aus einem kleinen Buch, das völlig zerfledderte, während sie die Redewendungen immer und immer wieder durchging, sich selbst Fragen stellte und sie beantwortete, bis ihre irische Zunge schließlich die italienischen Laute beherrschte.
Sie saß in ihrem Zimmer und wurde Zeugin, wie Mario und Gabriella heirateten; währenddessen nähte sie die ganze Zeit und ließ nicht eine Träne auf das Leinen fallen, das sie gerade bestickte. Die Tatsache, daß er zu ihr heraufsah, als die Glocken des kleinen Campanile läuteten, der zu der Kirche auf der
piazza
gehörte, war ihr genug. Er schritt, von seinen und Gabriellas Brüdern geleitet, zum Traualtar, weil ihm dieser Weg vorgezeichnet war. Es war eben Tradition, daß die Familien untereinander heirateten, um das Land zusammenzuhalten. Das hatte nichts mit seiner Liebe zu ihr oder mit ihrer Liebe zu ihm zu tun. Die wurde von so etwas nicht berührt.
Und sie sah von diesem Fenster aus auch zu, wie seine Kinder, eins nach dem anderen, zur Taufe in die Kirche gebracht wurden. In diesem Teil der Welt mußten Familien Söhne haben. Die Signora schmerzte das nicht. Denn sie wußte, wenn es nach ihm gegangen wäre, dann wäre sie – seine
principessa irlandese
– vor aller Augen die Seine gewesen.
Der Signora war klar, daß die meisten Männer in Annunziata von ihrem Verhältnis mit Mario wußten. Doch keinen störte das, es machte Mario in ihren Augen zu einem ganzen Kerl. Allerdings hatte sie stets geglaubt, daß die Frauen nichts von dieser Liebe ahnten. Nie war es ihr merkwürdig erschienen, daß man sie nicht einlud, mit den anderen zum Markt zu gehen, die Trauben zu lesen, die nicht fürs Keltern bestimmt waren, oder gemeinsam wilde Blumen für das Fest zu pflücken. Denn anscheinend waren alle glücklich und zufrieden damit, daß sie wunderschöne Kleider nähte, um die Statue Unserer Lieben Frau herauszuputzen.
Und im Lauf
Weitere Kostenlose Bücher