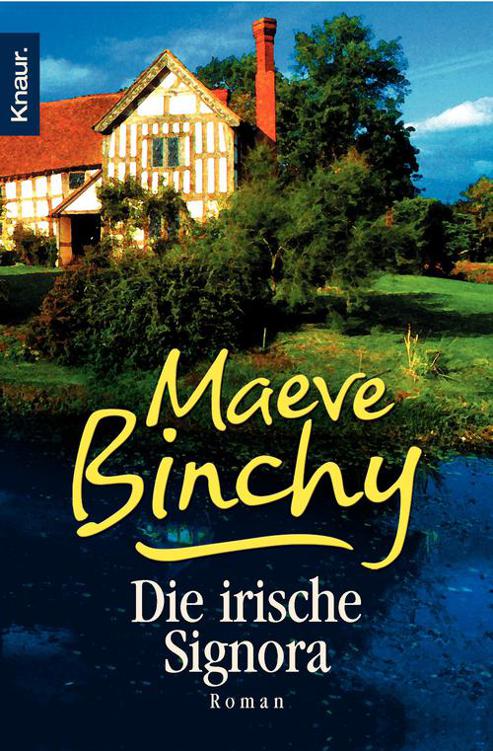![Die irische Signora]()
Die irische Signora
verbringen.
Hinter einem großen Baum verborgen saß die Signora, ihre Einkaufstüte auf dem Schoß, lange Zeit ruhig da und behielt die Nummer 23 im Auge. Da sie es gewohnt war, lange stillzusitzen, merkte sie nicht, wie die Zeit verging. Und sie trug auch nie eine Uhr, weil die Zeit keine Bedeutung für sie hatte. Die Signora beschloß zu warten, bis sie ihre Mutter zu Gesicht bekommen würde, wenn nicht heute, dann ein andermal. Erst wenn sie ihre Mutter gesehen hatte, würde sie wissen, was zu tun war. Vorher konnte sie keine Entscheidung treffen. Denn vielleicht würde sie ja Mitleid überwältigen oder kindliche Liebe, der Wunsch zu verzeihen? Vielleicht würde ihre Mutter aber auch eine Fremde für sie sein, die in der Vergangenheit ihre Liebe und Freundschaft verschmäht hatte.
Die Signora vertraute ihren Gefühlen. Sie wußte, daß sie dann klar sehen würde.
Doch an diesem Abend betrat niemand die Nummer 23, und es kam auch niemand heraus. Gegen zehn Uhr verließ die Signora ihren Posten und nahm einen Bus, der sie zu den Sullivans brachte. Leise schloß sie die Tür auf und ging nach oben, nur als sie am Wohnzimmer mit dem plärrenden Fernsehapparat vorbeikam, rief sie: »Guten Abend«. Jerry saß mit seinen Eltern vorm Fernseher. Kein Wunder, daß er in der Schule nicht aufpaßte, wenn er bis spät in die Nacht Western sehen durfte.
Die Sullivans hatten eine Kochplatte und einen alten Wasserkocher für sie aufgetrieben. So brühte sie sich einen Tee auf und sah hinaus auf die Berge.
Schon nach sechsunddreißig Stunden lag ein dünner Schleier über ihren Erinnerungen an Annunziata, mußte sie sich den Spaziergang hinauf zum Vista del Monte bewußt vergegenwärtigen. Ob Paolo und Gianna sie vermissen würden? Und würde sich Signora Leone fragen, wie es ihrer irischen Freundin in der fernen Heimat wohl erging?
Dann wusch sie sich mit der luxuriösen Seife, die nach Sandelholz duftete, und legte sich schlafen. Weder die Schüsse in den Saloons noch die wilde Jagd der Planwagen störten ihren langen, tiefen Schlummer.
Als sie aufstand, waren die anderen bereits außer Haus. Peggy war zu ihrer Arbeit im Supermarkt gegangen, Jimmy hatte eine Fuhre, und Jerry schlug in der Schule die Zeit tot. Auch sie machte sich auf den Weg. Heute würde sie das Haus ihrer Mutter am Vormittag überwachen und sich erst nachmittags auf Arbeitssuche begeben. Sie setzte sie sich wieder hinter denselben Baum, doch diesmal mußte sie nicht lange warten. Ein Kleinwagen fuhr bei Nummer 23 vor, und eine untersetzte, matronenhafte Frau, die roten Haare in kleine Löckchen gelegt, stieg aus. Der Signora verschlug es beinahe den Atem, als sie erkannte, daß es sich um ihre jüngere Schwester Rita handelte. Rita wirkte so ältlich, so gesetzt, dabei war sie doch erst sechsundvierzig. Als die Signora von Irland weggegangen war, war Rita noch ein junges Mädchen gewesen, und natürlich hatte sie in all den Jahren nicht nur keine liebevollen Briefe, sondern auch kein Foto von ihrer Familie bekommen. Das durfte sie nicht vergessen. Sie hatten ihr erst geschrieben, als sie sie brauchten, als sich um der lieben Bequemlichkeit willen die Mühe zu lohnen schien, mit dem schwarzen Schaf in Verbindung zu treten – mit dieser Verrückten, die Schande über sich gebracht hatte, indem sie einem verheirateten Mann nach Sizilien gefolgt war.
Rita wirkte steif und verkniffen.
Sie erinnerte die Signora an Gabriellas Mutter, eine kleine, verbitterte Frau, die mit ihrem kritischen Blick ständig und überall Mängel zu sehen schien, ohne sie näher benennen zu können. Es sind die Nerven, sagte man. Konnte diese Frau mit den hochgezogenen Schultern und den unbequemen, zu engen Schuhen wirklich ihre kleine Schwester Rita sein? Diese Frau, die jetzt zwölf Schrittchen trippelte, wo vier normale Schritte genügt hätten? Bestürzt spähte die Signora aus ihrem Versteck hervor. Die Autotür stand offen, Rita mußte gekommen sein, um ihre Mutter abzuholen. Vorsorglich machte sie sich auf einen neuen Schreck gefaßt. Denn wenn Rita so gealtert war, wie mochte dann erst ihre Mutter aussehen?
Und ihr fielen die alten Leute von Annunziata ein, die klein und oft über einen Stock gebeugt auf dem Dorfplatz saßen, die Vorbeigehenden betrachteten und dabei stets lächelten. Oft befühlten sie den Rock der Signora und bewunderten die Stickerei. »
Bella bellissima«,
nickten sie.
Ihre Mutter war bestimmt ganz anders , dachte die Signora, als sie die
Weitere Kostenlose Bücher