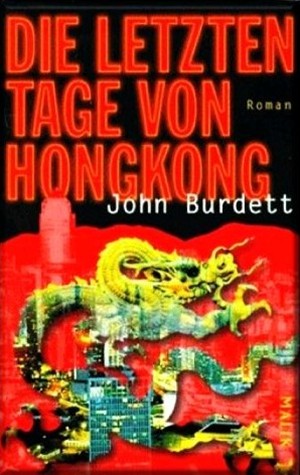![Die letzten Tage von Hongkong]()
Die letzten Tage von Hongkong
nördlichen Völker, Antworten in Büchern zu suchen.
Chan hatte viel über das moderne China gelesen und über die Briten, die Kolonialherren von Hongkong. Er war zu dem Schluß gekommen, daß die Briten das größere Rätsel darstellten. Sie waren zum größten Teil aufgeblasene Narren ohne jedes Feingefühl, rassistische Ausbeuter, die den Reichtum der östlichen Kulturen nie richtig verstanden hatten. Doch hin und wieder schien aus diesem unsensiblen Volk ein Genie zu erwachsen, das sich nicht mit anderen Menschen vergleichen ließ. Das beste, scharfsinnigste Buch, das er je über China gelesen hatte, stammte von einem Engländer, der nie in diesem Land gewesen war und auch nicht wußte, daß er über die Chinesen schrieb. Durch einen unheimlichen Zufall wurde Orwells Neunzehnhundertvierundachtzig im selben Jahr veröffentlicht, in dem Mao die Volksrepublik China begründete. Die ganze Brutalität und Perversion von Maos Herrschaft lag in dem ersten Satz des Buches, den Chan sich als Zweizeiler, wie ein chinesisches Gedicht, gemerkt hatte:
Es war ein strahlend-kalter Tag im April, und die Uhren schlugen dreizehn.
Aus Orwells grauer Hölle war Mai-mai entflohen, und dorthin war sie auch wieder zurückgekehrt. Chan suchte in den Büchern hauptsächlich nach Mai-mai, und es fiel ihm nicht schwer, sie zu finden. Sie war gewissermaßen eine Verkörperung von Asien im zwanzigsten Jahrhundert: eine einfache Bäuerin, gefangen zwischen zwei unerbittlichen Systemen, die sie zermalmten. Um drei Uhr morgens, ganz allein mit den Neonlichtern, die von draußen hereindrangen, fragte sich Chan, ob mit ihrem Sohn nicht das gleiche passierte.
Eigentlich, das wußte er, hätte er sich darauf konzentrieren sollen, sich aus diesem Dilemma zu befreien. Manchmal drohten ihn die Angst vor falschen Anschuldigungen und so etwas wie eine geistige Übelkeit zu ersticken und mit Mordlust zu erfüllen. Doch merkwürdigerweise verging das bald schon wieder. Den größten Teil der Zeit vermischte sich in seiner Wahrnehmung sein eigenes Schicksal mit dem Milliarden anderer Menschen. Häufig kam ihm das Bild eines alten Chinesen mit langem, dünnem Bart und so gar nicht zu ihm passendem John-Lennon-T-Shirt in den Sinn und gab ihm ein Zeichen wie ein Weiser aus alten Zeiten.
Chan wußte seit Kindertagen um seine fatale Neigung, sich in tragische Figuren einzufühlen. Die wenigen Male, die er mit Jenny im Kino gewesen war, hatte er sich zu sehr mit dem Helden identifiziert. Jenny dagegen war völlig in den Action-Szenen aufgegangen: Pferde, Waffen und Blut stimmten sie fröhlich.
Der alte Mann zog Chan an wie eine Geliebte, obwohl Chan wußte, daß er mit Schmerz, Scham und Niederlagen zu rechnen hatte. Am Donnerstagabend ging er nach Wanchai und kaufte unterwegs eine Flasche Jack Daniels, den Lieblingsdrink des Alten. Als er bei ihm anlangte, war dieser ganz allein und verdrießlich gestimmt.
»Was ist mit deiner Verabredung und deinen Nachwuchsleuten?«
Der alte Mann zuckte mit den Achseln. »Die haben beide neuseeländische Pässe. Was machen die sich schon aus laogai? Denen kann ein Viertel der Weltbevölkerung gestohlen bleiben.«
»Wie weit bist du gekommen?«
»Nicht mal bis zu den Bildern. Seit ich sie dir gezeigt habe und du ausgeflippt bist, habe ich über die Fotos geschwiegen.«
»Ich bin ein Sonderfall. Die haben meine Mutter umgebracht.«
»So ein Sonderfall ist das auch wieder nicht. Die haben eine Million Mütter umgebracht.«
»Soll ich gehen?«
»Ich wollte, daß du pünktlich da bist. Du hättest das Zünglein an der Waage sein können.«
»Tut mir leid.«
Der alte Mann redete sich in Rage. »Warum sind alle so gleichgültig? Das chinesische Gefängnissystem, das laogaidui, verwendet Sklaven, Sklaven, um Wein, Tee, Papier, Autos, Opium und Heroin herzustellen, das es dem Westen verkauft. Fast fünfzig Millionen Menschen sind seit 1949 Gefangene des laogai gewesen – das ist fast die gesamte Bevölkerung Englands. Und niemand schert sich drum. Warum? Als Solschenizyn über den Gulag geschrieben hat, haben sie ihn fast zum Heiligen erklärt.«
»Du weißt genau, warum. Wir sind Asiaten. Die Weißen können nicht viel mit uns anfangen. Für die sind wir letztlich sowieso nur Sklaven. Vor weniger als hundert Jahren haben wir uns gegenseitig in die Sklaverei nach Brasilien und auf die Westindischen Inseln verkauft. Die scheren sich nicht um uns, weil wir uns selbst nicht wichtig nehmen. Hier, trink
Weitere Kostenlose Bücher