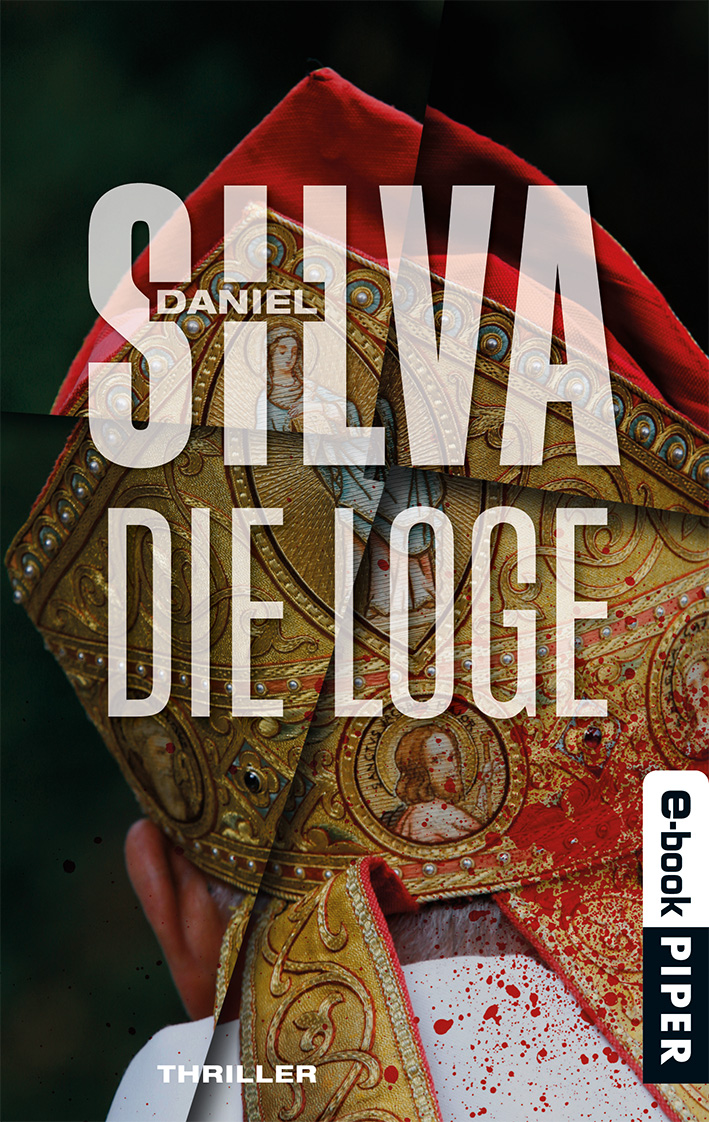![Die Loge]()
Die Loge
roch er Fleisch und Zwiebeln, die in Olivenöl brieten. Dennoch kam er sich vor wie ein Mann, der in eine Geisterstadt heimkehrt, in der Wohnhäuser und Geschäfte noch stehen, während ihre einstigen Bewohner längst verschwunden sind.
Die Bäckerei, in der er sich mit Schamron getroffen hatte, war geschlossen. Er ging die wenigen Schritte zur Nummer 2899 weiter. Auf einem kleinen Schild an der Tür stand: COMUNITÀ EBRAICA DI VENEZIA. Gabriel klingelte und hörte einen Augenblick später eine Frauenstimme aus dem Lautsprecher der Sprechanlage: »Ja, Sie wünschen?«
»Mein Name ist Mario Delvecchio. Ich habe einen Termin beim Rabbi.«
»Augenblick, bitte.«
Gabriel kehrte dem Haus den Rücken zu, um den Platz zu beobachten. Aus dem Augenblick wurden zwei, dann drei. Das lag an dem Krieg in den Palästinensergebieten. Er machte jedermann nervös. In ganz Europa waren in allen jüdischen Einrichtungen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden. Venedig war bisher verschont geblieben, aber in Rom und in mehreren Städten Frankreichs und Österreichs waren Anschläge auf Friedhöfe und Synagogen verübt und Juden auf der Straße angegriffen worden. Die Medien bezeichneten dies als die schlimmste öffentliche Antisemitismuswelle, die seit dem Zweiten Weltkrieg über Europa hinweggerollt war. In solchen Zeiten verabscheute Gabriel die Tatsache, daß er sein Judentum verbergen mußte.
Endlich summte der Türöffner, danach folgte ein Klicken, und das Schloß war entriegelt. Gabriel drückte die Tür auf und stand in einem ziemlich düsteren Korridor. Am anderen Ende befand sich eine zweite Tür. Als er sich ihr näherte, wurde sie ebenfalls für ihn entriegelt.
Er betrat ein kleines, mit Papierkram vollgestopftes Büro. Wegen der im Ghetto vorherrschenden Atmosphäre allgemeinen Niedergangs war er auf eine italienische Version von Frau Ratzinger gefaßt – eine furchterregende Alte in schwarzen Witwengewändern. Statt dessen wurde er zu seiner großen Überraschung von einer hochgewachsenen, schönen Frau Ende Zwanzig begrüßt. Sie hatte lange, schwarze Locken mit kastanienbraunen und rötlichen Strähnen. Eine Nackenspange schaffte es kaum, die Haarfülle zu bändigen, die sich fast ungezügelt über zwei athletisch breite Schultern ergoß. Die karamelbraunen Augen waren goldgefleckt. Ihre Lippen sahen aus, als versuche sie, ein Lächeln zu unterdrücken. Sie war sich ihrer Wirkung offenbar sehr wohl bewußt.
»Der Rabbi ist noch zum maariw in der Synagoge. Er hat mich gebeten, Sie zu unterhalten, bis er zurückkommt. Ich bin Chiara. Ich koche gerade Kaffee. Möchten Sie einen?«
»Ja, gern.«
Sie goß aus dem Espressobereiter, der auf einer Heizplatte stand, eine kleine Tasse ein, fügte Zucker hinzu, ohne Gabriel zu fragen, ob er welchen wolle, und gab ihm die Tasse. Als er sie entgegennahm, fielen ihr die Farbreste an seinen Fingern auf. Er war aus Tiepolos Büro direkt ins Ghetto gefahren und hatte keine Zeit gehabt, sich gründlich die Hände zu waschen.
»Sie sind Maler?«
»Nicht ganz – ich restauriere Bilder.«
»Wie faszinierend! Wo arbeiten Sie gerade?«
»In der Kirche San Zaccaria.«
Sie lächelte. »Ah, eine meiner liebsten Kirchen. An welchem Gemälde? Doch nicht am Bellini?«
Gabriel nickte.
»Dann müssen Sie sehr gut sein.«
»Bellini und ich sind alte Freunde, könnte man sagen«, antwortete Gabriel bescheiden. »Wie viele Leute kommen zum maariw ?«
»Normalerweise einige der älteren Männer. Manchmal mehr, manchmal weniger. An manchen Abenden ist der Rabbi in der Synagoge allein. Er ist der festen Überzeugung, daß diese Gemeinde an dem Tag verschwindet, an dem er aufhört, das Abendgebet zu sprechen.«
In diesem Augenblick betrat der Rabbi das Büro. Auch er war noch relativ jung, stellte Gabriel überrascht fest. Er war nur wenige Jahre älter als er selbst, sportlich und lebhaft, mit dichtem silbernen Haar unter seinem schwarzen Filzhut und sorgfältig gestutztem Bart. Er schüttelte Gabriel herzlich die Hand und begutachtete ihn durch seine Nickelbrille.
»Ich bin Rabbi Zolli. Hoffentlich war meine Tochter in meiner Abwesenheit eine freundliche Gastgeberin. Aber ich fürchte, daß sie in den letzten Jahren zu viel Zeit in Israel verbracht und daher alle guten Manieren eingebüßt hat.«
»Sie war sehr liebenswürdig, aber sie hat nicht gesagt, daß Sie Ihre Tochter ist.«
»Sehen Sie? Immer Unfug im Sinn.« Der Rabbi wandte sich an seine Tochter. »Geh jetzt nach
Weitere Kostenlose Bücher