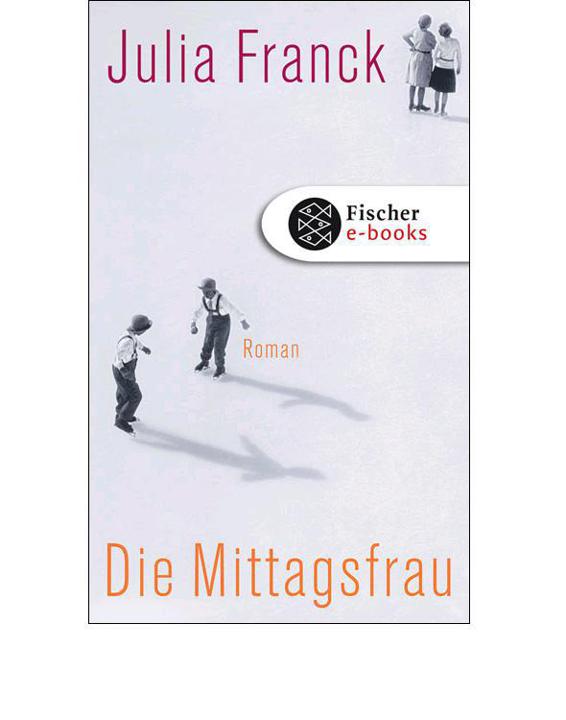![Die Mittagsfrau: Roman (German Edition)]()
Die Mittagsfrau: Roman (German Edition)
Helene endlich zuhören sollte, sie müsse etwas trinken, sie solle auch etwas essen. Das konnte sich Helene nicht vorstellen.
Sie konnte sitzen, sie wusste nicht, ob sie schlucken konnte. Sie versuchte es, sie schluckte, sie stellte das Glas zurück. Das konnte für den Morgen reichen, vielleicht.
Mittags stürzte sie den kalten Tee hinunter und trank in einem Zug aus dem Wasserkrug vom Waschtisch. Der Krug war leer, ihr Hals schmerzte vom Dehnen und Schließen des Trinkens. Dann setzte sich Helene wieder und wartete nicht. Es vergingen Tage.
War Martha arbeiten, so lag Helene auf dem Rücken auf ihrem Bett und ächzte, manchmal weinte sie leise.
Als Martha und Leontine sagten, Helene solle den Mantel anziehen, zog sie den Mantel an und folgte ihnen. Martha ging hinüber zum Viktoria-Luise-Platz Nummer elf und holte Helenes Sachen von oben runter, sie gab Helenes Schlüssel der Vermieterin zurück und bat sie, den Eltern von Carl nicht zu sagen, dass Helene dort gewohnt hatte. Die Miete war von Carls Eltern bis zum Monatsende bezahlt.
Helene hatte sich auf dem Platz vor dem Haus auf die Bank gesetzt. Sie hatte in das Becken des leeren Springbrunnens geschaut und den Spatzen zugesehen, die am Rand der kleinen Pfützen hüpften und ihre Schnäbel ins Wasser stießen. Sie badeten, das Wasser musste eiskalt sein.
Martha und Leontine wollten, dass Helene möglichst viel rausging, sich bewegte. Helene bewegte sich. Martha sagte, Helene müsse etwas essen, Leontine widersprach, sie müsse gar nichts. Der Hunger käme von allein wieder. Es war nur gut, dass Helene auf nichts mehr wartete, auf den Hunger nicht, nicht auf das Essen. Der Sonntag kam. Helene dachte an die Verabredung, die Carl und sie für diesen Tag mit Carls Eltern gehabt hatten. Ob seine Eltern beteten? Gott war nicht da, sie hörte keine Stimme, kein Zeichen erschien. Helene wusste nicht, wann es eine Beerdigung gab. Sie fand nicht den Mut, zum Telefonapparat zu gehen, war sie doch eine Fremde und wollte sie seine Familie besonders jetzt nicht stören. Die Zeit zog sich zusammen, sie rollte sich ein und faltete sich.
Der Sonntag war vergangen, andere Sonntage würden vergehen.
Die Sonne schien wärmer, die Krokusse blühten auf den Rabatten der breiten Straßen. Leontine und Martha verabschiedeten sich, Leontine wollte Martha für einen Monat in ein Sanatorium bringen. Das Gleichgewicht, Balance klang soviel leichter. Sie müsse sich erholen und die Gifte sollten ihren Körper verlassen. Martha weinte beim Abschied, es tat ihr leid, dass sie ausgerechnet jetzt für ihr Engelchen nicht da sein könne. Martha klammerte sich an Helene fest, sie umschlang sie mit ihren dünnen und langen Armen, dass Helene kaum noch Luft holen konnte. Wozu brauchte man schon Luft? Helene wehrte sich nicht. Leontine musste Martha mit sich fortziehen, Martha tobte, sie beschimpfte Leontine mit Ausdrücken, wie Helene sie noch nicht gehört hatte.
Wehe, du trennst mich von meiner Schwester, du Niederträchtige, du trennst mich nicht.
Aber Leontine war ihrer Sache sicher, es führte kein Weg daran vorbei, sie wollte Martha nicht verlieren, also musste sie sie aus der Stadt bringen, für einen Monat vielleicht, vielleicht für zwei. Leontine zog Martha mit sich fort, mit Gewalt erst, dann mit Strenge. Helene hörte, wie Leontine Martha noch beim Verlassen der Wohnung zuredete, wie man einem Tier zuredete, ohne Antwort. Ohne Martha empfand Leontine für sich allein wohl nicht das Recht, in Fannys Wohnung zu logieren. Helene fragte Leontine nicht, ob sie nun wieder bei ihrem Mann lebte.
Sie sah Leontine kaum noch. Einmal brachte Leontine Fanny Medikamente, ein anderes Mal holte sie ihre Winterschuhe ab, die sie vergessen hatte. Helene brachte Leontine zur Tür. Dort wandte sich Leontine zu Helene um und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Martha braucht mich. Du weißt, dass ich mich jetzt um sie kümmern muss? Helene nickte, ihre Augen brannten. Sie wollte ihre Arme um Leontine legen, sie festhalten, aber sie errötete nur. Und Leontine ließ die Hand von ihrer Schulter gleiten, öffnete die Tür und ging.
Helene schlief jetzt allein in dem Zimmer zum Hof, sie hatte die Betten wieder auseinandergestellt. Sie ging in die Apotheke arbeiten und war froh, dass der Apotheker sein Beileid mit Zurückhaltung zeigte. Er drang mit keinerlei Fragen in Helene. Dabei konnte er kaum wissen, wie taub sich Helene fühlte. Im Frühling sagte der Apotheker zu Helene, sie werde immer
Weitere Kostenlose Bücher