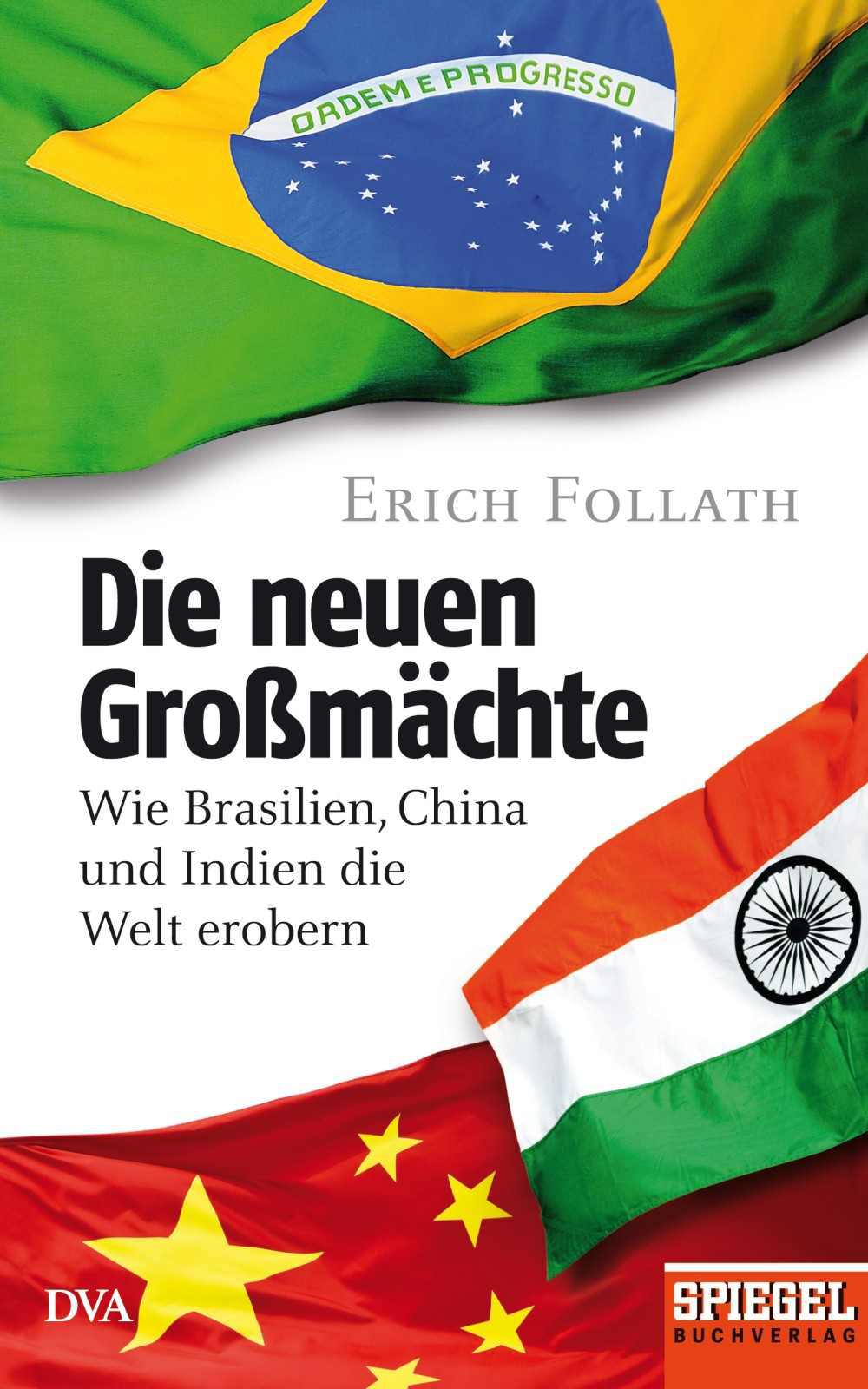![Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)]()
Die neuen Großmächte: Wie Brasilien, China und Indien die Welt erobern - Ein SPIEGEL-Buch (German Edition)
später vehement. Brasilien habe »kein Motiv« für den Bau einer solchen Waffe, und seine Verfassung schreibe »als einzige auf der ganzen Welt« eine ausschließlich zivile Nutzung der Atomkraft vor. Allerdings habe sein Land »die modernsten Zentrifugen der Welt« entwickelt und sehe keinen Grund, diesen Technologievorsprung mit den UNO -Inspektoren zu teilen. Der Minister, der einmal behauptet hat, es sei ein Fehler Brasiliens gewesen, überhaupt dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten, bekräftigte seine Kritik an dem Abkommen. »Wir erfüllen unsere Verpflichtungen. Aber der Vertrag ist asymmetrisch, er bevorzugt die Atommächte. Sie reden immer nur von der Nichtverbreitungsklausel, nicht von dem Abrüstungsgebot. Aber wo ist denn ein Atomkrieg möglich? Doch nur da, wo es Waffen gibt.« Und dann verteidigte er die Entwicklung der atomgetriebenen U-Boote durch das brasilianische Militär. Dabei gehe es ja nicht um Angriffswaffen. »Wir haben eine riesige Küste, die es zu überwachen gilt. Unter dem Meeresgrund liegen riesige Ölvorkommen. Wir brauchen eine schlagkräftige Verteidigung. Ein U-Boot mit Nuklearantrieb kann nun mal viel länger unter Wasser bleiben als ein konventionelles.«
Dass sich die Welt so viel weniger Sorgen um Brasilien macht als um Iran, liegt an der funktionierenden Demokratie im größten südamerikanischen Land, an den wirtschaftlichen und sozialen Erfolgen. Und an der Macht, die Brasilien im Windschatten der Globalisierung als Global Player gewonnen hat. Der Lateinamerika-Experte Nicholas Lemann findet im New Yorker im Dezember 2011 dafür geradezu hymnische Worte. »Unter den großen Wirtschaftsmächten hat Brasilien lange Zeit etwas ganz Seltenes geschafft, ein Dreifachwunder: hohes Wirtschaftswachstum (anders als die USA und Europa), politische Freiheit (anders als China) und einen Rückgang der Ungleichheit zwischen den Bevölkerungsgruppen (anders als praktisch überall sonst).«
Auf die Frage eines Reporters, ob sie eine ungefähre Ahnung habe, wie viele neue Arbeitsplätze im ersten Halbjahr ihrer Präsidentschaft zusätzlich entstanden seien, sagt die Präsidentin: »Eine Millionfünfhundertdreiundneunzigtausendundfünfhundertsie-benundzwanzig.« Wo ihr Vorgänger lieber in der Menge badete (oder mit politischen Kumpels biertrinkend kungelte), da vertieft sie sich in Sachbücher wie Karl Kautskys Die Sozialisierung der Landwirtschaft . Begeistert sich für Belletristik – ihr literarisches Lieblingswerk ist T. S. Eliots »Aschermittwoch« – und, seit Jugendjahren, für die griechische Mythologie. In den Neunzigerjahren hat sie sich einmal sogar in einen Kurs über die griechische Tragödie eingeschrieben – vielleicht auch ein Stück Aufarbeitung ihrer eigenen Lebensgeschichte und der ihrer gefolterten Genossen, die es nicht geschafft haben. Sie kann sich sehr gut in ihren Kokon zurückziehen, sagen Freunde. Und verbergen, wie verletzlich sie ist. Und wie abgehoben und auch beratungsresistent. Deshalb wohl wirkt sie bei der Protestwelle im Sommer 2013 so hilflos.
Nach außen freilich ist sie eher »Dilma der Traktor«. So lautet der nicht besonders charmante Spitzname, den das politische Umfeld ihr gegeben hat. Er soll für Durchsetzungsvermögen stehen, für das Beseitigen aller in den Weg geworfenen Hindernisse. Für das fruchtbare Ackern und Bestellen des Bodens. So in etwa tritt Dilma Rousseff auch vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen auf. Es ist die 66. Sitzung des Weltgremiums, und sie ist die erste Frau in der Geschichte, die im Oktober 2011 ein solches Gremium eröffnen darf. Es ist auch ein symbolischer Auftritt: Brasilien nimmt seinen wichtigen Platz unter den Nationen ein. Man hört diesem Land und seiner Präsidentin aufmerksam zu. Sie spricht über die gängigen Themen, Klimawandel, Finanzkrise, Energiesicherheit. Nichts Sensationelles. Sie betont auch besonders das Selbstbestimmungsrecht der Völker und setzt sich ausdrücklich für die Rechte der Palästinenser ein, konkret für eine Vollmitgliedschaft. Das ist nicht die Position Washingtons, Londons und Berlins. Aber darauf muss Brasiliens Präsidentin keine Rücksicht nehmen. Sie ist die Sprecherin der BRIC S, der neuen Mächte. Verfechterin einer anderen Weltordnung, gewichtige Repräsentantin einer multipolaren Welt. Und da werden die Akzente anders gesetzt – an der Seite Chinas und Indiens ist Brasilien strikt gegen jede Intervention auf das Territorium souveräner Staaten. So war es im
Weitere Kostenlose Bücher