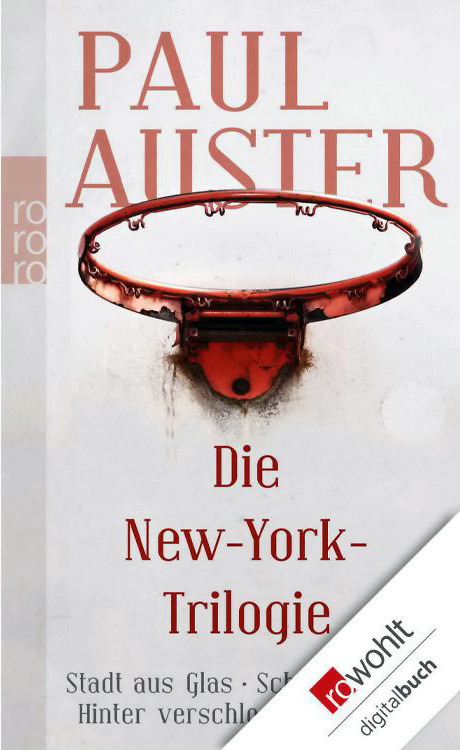![Die New-York-Trilogie: Stadt aus Glas. Schlagschatten. Hinter verschlossenen Türen]()
Die New-York-Trilogie: Stadt aus Glas. Schlagschatten. Hinter verschlossenen Türen
wurden die Riegel zurückgeschoben, und dann stand Sophie Fanshawe vor mir und hielt ein kleines Baby im Arm. Als sie mich anlächelte und mich bat einzutreten, zupfte das Baby an ihrem langen braunen Haar. Sie wich sanft aus, nahm das Kind mit beiden Händen und drehte es mit dem Gesicht mir zu. Das sei Ben, erklärte sie, Fanshawes Sohn, und er sei vor gerade dreieinhalb Monaten geboren worden. Ich gab vor, das Baby zu bewundern, das mit den Armen ruderte und dem weißlicher Speichel vom Kinn tropfte, aber ich war mehr an seiner Mutter interessiert. Fanshawe hatte Glück gehabt. Die Frau war schön, sie hatte dunkle, intelligente, mit ihrem festen Blick beinahe wilde Augen. Sie war schmächtig, nicht mehr als durchschnittlich groß, und es lag etwas Langsames in ihren Bewegungen, was sie zugleich sinnlich und aufmerksam wirken ließ, so als betrachtete sie die Welt aus einer tiefen inneren Wachsamkeit heraus. Kein Mann würde diese Frau aus eigenem, freien Willen verlassen haben – vor allem nicht, wenn sie sein Kind erwartete. So viel stand für mich fest. Noch bevor ich die Wohnung betrat, wusste ich, dass Fanshawe tot sein musste.
Es war eine kleine Vierzimmerwohnung, spärlich möbliert; in einem Zimmer standen Bücherregale und ein Arbeitstisch, eines war als Wohnzimmer eingerichtet, die letzten beiden waren Schlafzimmer. Alles war sauber aufgeräumt, im Einzelnen etwas heruntergekommen, aber im Ganzen nicht ungemütlich. Wenn schon sonst nichts, so bewies es, dass Fanshawe seine Zeit nicht damit verbracht hatte, Geld zu verdienen. Aber ich war keiner, der auf Schäbigkeit verächtlich herabblickte. Meine eigene Wohnung war noch enger und dunkler als diese, und ich wusste, was es heißt, jeden Monat zu kämpfen, um die Miete aufbringen zu können.
Sophie Fanshawe bot mir einen Sessel an, schenkte mir eine Tasse Kaffee ein und setzte sich dann auf das verschlissene blaue Sofa. Mit dem Baby auf dem Schoß erzählte sie mir die Geschichte von Fanshawes Verschwinden.
Sie hatten sich vor drei Jahren in New York kennengelernt. Innerhalb eines Monats waren sie zusammengezogen, und weniger als ein Jahr danach hatten sie geheiratet. Fanshawe war kein Mann, mit dem es sich leicht leben ließ, aber sie liebte ihn, und in seinem Verhalten hatte es nie etwas gegeben, was darauf deutete, dass er sie nicht liebte. Sie waren glücklich gewesen; er hatte sich auf die Geburt des Babys gefreut. Es hatte kein böses Blut zwischen ihnen gegeben. Eines Tages im April sagte er ihr, er wolle am Nachmittag nach New Jersey fahren, um seine Mutter zu besuchen, und dann kam er nicht zurück. Als Sophie ihre Schwiegermutter spät an diesem Abend anrief, erfuhr sie, dass Fanshawe sie gar nicht besucht hatte. So etwas war noch nie geschehen, aber Sophie beschloss zu warten. Sie wollte keine dieser Frauen sein, die in Panik geraten, wenn ihr Mann einmal nicht nach Hause kommt, und sie wusste, dass Fanshawe mehr Raum zum Atmen brauchte als die meisten Männer. Sie beschloss sogar, keine Fragen zu stellen, wenn er wieder heimkommen würde. Aber dann verging eine Woche und noch eine Woche, und schließlich ging sie zur Polizei. Wie sie erwartet hatte, war man nicht sonderlich beunruhigt wegen ihres Problems. Wenn es keinen Hinweis auf ein Verbrechen gab, konnte man wenig tun. Jeden Tag verließen Männer ihre Frauen, und die meisten wollten nicht gefunden werden. Die Polizei zog einige routinemäßige Erkundigungen ein, erfuhr nichts und schlug ihr vor, einen Privatdetektiv anzustellen. Mit der Unterstützung ihrer Schwiegermutter, die anbot, die Kosten zu übernehmen, nahm sie die Dienste eines Mannes namens Quinn an. Quinn arbeitete fünf oder sechs Wochen lang hartnäckig an dem Fall, aber zuletzt gab er auf und wollte ihr Geld nicht mehr. Er sagte Sophie, dass Fanshawe höchstwahrscheinlich noch im Lande sei, aber ob lebendig oder tot, könne er nicht sagen. Quinn war kein Scharlatan. Sophie fand ihn sympathisch, er war ein Mann, der wirklich helfen wollte, und als er an jenem letzten Tag zu ihr kam, erkannte sie, dass es unmöglich war, gegen seinen Urteilsspruch anzugehen. Man konnte nichts tun. Wenn Fanshawe beschlossen hätte, sie zu verlassen, würde er sich nicht ohne ein Wort davongeschlichen haben. Es sah ihm nicht ähnlich, vor der Wahrheit zurückzuscheuen, unangenehmen Gesprächen auszuweichen. Sein Verschwinden konnte daher nur eines bedeuten: dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen war.
Aber Sophie hoffte noch immer, dass
Weitere Kostenlose Bücher