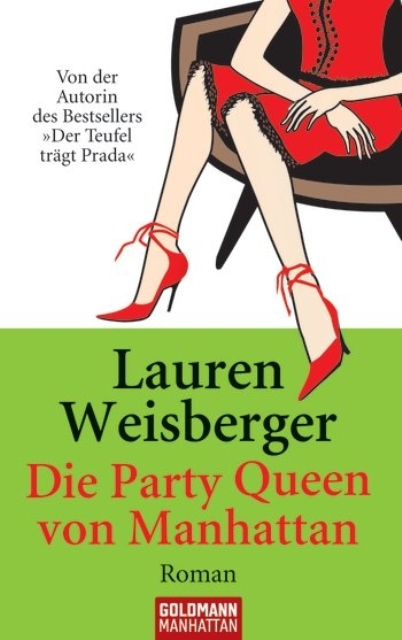![Die Party Queen von Manhattan - Roman]()
Die Party Queen von Manhattan - Roman
natürlich toll, dass sie sich genau mit solchen Sachen auskannte und schon überall gewesen war. Es dauerte nicht einmal bis zu den Weihnachtsferien, da waren wir unzertrennlich. Und am Ende des ersten Studienjahrs zog ich endgültig einen Schlussstrich unter meine alternative Vergangenheit, indem ich meine Grateful-Dead-T-Shirts in den Müll warf. Jerry war sowieso schon lange tot. Penelope und
ich hatten jede Menge Spaß, zusammen und mit anderen. Für mich war es eine höchst willkommene Abwechslung, einmal nicht mit Leuten abzuhängen, die sich Dreadlocks in die Haare machten, ihr Badewasser recycelten und nach Patschuliöl müffelten. Endlich war ich nicht mehr die Ökoaußenseiterin, die sich viel zu gut mit der Rettung der Mammutbäume auskannte. Ich trug die gleichen Jeans und T-Shirts wie alle anderen, ohne lange zu fragen, ob sie in einem Ausbeuterbetrieb hergestellt worden waren oder nicht. Ich aß die gleichen Hamburger und trank das gleiche Bier. Es war eine herrliche Zeit, vier wunderbare Jahre unter Gleichgesinnten, von denen nicht ein einziger zum Friedenskorps wollte. Und als dann die großen Firmen auf dem Campus erschienen und mit fetten Gehältern lockten, mit dicken Prämien winkten und uns auch noch zum Vorstellungsgespräch nach New York einflogen, griff ich zu, genau wie der Rest meiner Collegeclique. Dafür gab es einen einfachen Grund: Wie sonst hätte man sich als zweiundzwanzigjähriger Berufsanfänger die Miete in Manhattan leisten können? Und nach Manhattan zog es uns alle.
Ich konnte es immer noch nicht fassen, wie rasend schnell die letzten fünf Jahre vergangen waren, wie von einem Schwarzen Loch verschluckt, in einem Wirbel aus Trainingsprogrammen, Vierteljahresberichten und Jahresendausschüttungen. Mir blieb kaum Zeit, darüber nachzudenken, wie sehr ich meine Arbeit hasste. Dass ich zu allem Überfluss auch noch gut darin war, machte die Sache nicht besser. Im Gegenteil, es schien der Beweis dafür zu sein, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Aber Will wusste und spürte, dass sie falsch war. Und wenn ich nicht so bequem gewesen wäre, hätte ich mir längst etwas anderes gesucht.
»Was ich mir vom Leben wünsche? Sag bloß, darauf erwartest du im Ernst eine Antwort?«, gab ich zurück.
»Wieso denn nicht? Wenn du nicht bald die Kurve kriegst,
wachst du eines schönes Tages auf und bist vierzig. Und man hat dich zur Vizepräsidentin befördert. Und was dann? Dann stürzt du dich von der nächsten Brücke. Am Bankgewerbe ist nichts auszusetzen, Darling, es ist bloß nicht die richtige Branche für dich. Du brauchst einen Beruf, in dem du mit Menschen zu tun hast, in dem du auch einmal lachen kannst. Ich finde, du solltest schreiben . Und dich natürlich sehr viel besser kleiden.«
Dass ich seit ein paar Monaten mit dem Gedanken spielte, mir eine Stelle im gemeinnützigen Bereich zu suchen, verschwieg ich ihm lieber. Wenn er erfuhr, dass seine Bemühungen, mich vom Gutmenschentum abzubringen, gescheitert waren, würde er für den Rest des Abends mit einer Leichenbittermiene am Tisch sitzen. Als ich einmal unvorsichtigerweise eine leise Andeutung darüber gemacht hatte, in welche Richtung ich mich beruflich umorientieren wollte, war er alles andere als entzückt gewesen. Sich sozial zu engagieren sei zwar eine noble Geste, gewiss, doch solche Pläne würden mich unweigerlich wieder auf den Pfad führen, der mich - ich zitiere - schnurstracks in den Kreis der Ökofreaks und Müslimampfer zurückbeförderte. Also widmeten wir uns lieber den üblichen Themen. Zuerst kam mein nicht vorhandenes Liebesleben an die Reihe (»Darling, du bist viel zu jung und viel zu hübsch, um mit deiner Arbeit verheiratet zu sein.«). Als Nächstes ließ Will eine Tirade über die Leser seiner Kolumne los (»Ist es vielleicht meine Schuld, dass der belehrungsresistente Plebs die Wahrheit über seine gewählten Amtsträger nicht mehr hören will?«). Dann versetzte uns ein Zeitsprung kurz in meine Phase als Umweltaktivistin an der Highschool zurück (»Gott sei Dank, dass die Ära der Räucherstäbchen passé ist!«), und zuletzt knöpfte er sich noch einmal meine Garderobe vor. (»Schlecht sitzende, maskuline Hosen sind kein Outfit für ein Rendezvous.«)
Als er gerade zu einem Monolog über die Vorzüge eines Chanelkostüms
angesetzt hatte, wurden wir zu Tisch gebeten. Wir nahmen unsere Drinks mit und begaben uns ins Esszimmer.
»Na, einen produktiven Tag gehabt?« Simon begrüßte
Weitere Kostenlose Bücher