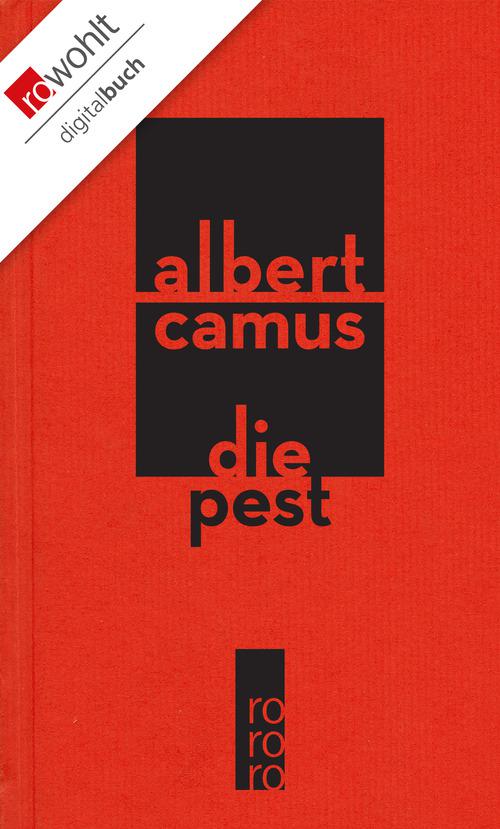![Die Pest (German Edition)]()
Die Pest (German Edition)
unseren Mitbürgern, die damals ihr Leben riskierten, mussten entscheiden, ob sie es mit der Pest zu tun hatten oder nicht und ob man gegen sie ankämpfen musste oder nicht.
Viele neue Moralprediger liefen damals in unserer Stadt herum und sagten, nichts nütze etwas und man müsse auf die Knie fallen. Und Tarrou, Rieux und ihre Freunde mochten dies oder das antworten, die Schlussfolgerung bestätigte immer, was sie wussten: Man musste auf die eine oder andere Art kämpfen und nicht auf die Knie fallen. Es ging nur darum, so viele Menschen wie möglich vor dem Sterben und der endgültigen Trennung zu bewahren. Dafür gab es nur ein einziges Mittel, nämlich die Pest zu bekämpfen. Diese Wahrheit war nicht sehr schön, sie war nur folgerichtig.
Deshalb war es normal, dass der alte Castel sein ganzes Vertrauen und seine Energie dareinsetzte, an Ort und Stelle und mit behelfsmäßigem Material Impfstoff herzustellen. Rieux und er hofften, dass ein aus den Kulturen der in der Stadt grassierenden Mikrobe hergestelltes Serum direkter wirkte als der von außen kommende Impfstoff, da die Mikrobe leicht vom klassischen Erscheinungsbild des Pestbazillus abwich. Castel hoffte, sein erstes Serum ziemlich schnell zu gewinnen.
Deshalb war es auch natürlich, dass Grand, der nichts von einem Helden hatte, jetzt eine Art Sekretariat der Sanitätstrupps übernahm. Ein Teil der von Tarrou gebildeten Gruppen widmete sich nämlich der vorbeugenden Behandlung in den übervölkerten Vierteln. Man versuchte dort die nötige Hygiene einzuführen, man zählte die Dachböden und Keller, die nicht desinfiziert worden waren. Ein anderer Teil der Gruppen half den Ärzten bei den Hausbesuchen, sorgte für den Transport der Pestkranken und fuhr später, als das geeignete Personal fehlte, die Wagen mit den Kranken und Toten. Das alles musste registriert und statistisch erfasst werden, und Grand hatte sich zu dieser Arbeit bereit gefunden.
Unter diesem Gesichtspunkt scheint Grand dem Erzähler eher als Rieux oder Tarrou der wahre Vertreter jener ruhigen Kraft zu sein, die die Sanitätstrupps beseelte. Er hatte mit der ihm eigenen Gutwilligkeit ohne Zögern ja gesagt. Er hatte nur darum gebeten, sich mit kleinen Arbeiten nützlich zu machen. Für alles Übrige sei er zu alt. Er könne seine Zeit von achtzehn bis zwanzig Uhr zur Verfügung stellen. Und als Rieux ihm herzlich dankte, wunderte er sich: «Das ist nicht das Schwerste. Wir haben die Pest, wir müssen uns wehren, das ist klar. Ach, wenn alles so einfach wäre!» Und er kam auf seinen Satz zurück. Manchmal abends, wenn die Arbeit an den Karteikarten erledigt war, unterhielt sich Rieux mit Grand. Irgendwann hatten sie auch Tarrou in ihr Gespräch einbezogen, und Grand vertraute sich mit immer offensichtlicherem Vergnügen seinen beiden Gefährten an. Diese verfolgten interessiert die geduldige Arbeit, die Grand inmitten der Pest fortsetzte. Schließlich fanden auch sie darin eine Art Entspannung.
«Wie geht es der Amazone?», fragte Tarrou oft. Und Grand antwortete mit gezwungenem Lächeln unweigerlich: «Sie trabt, sie trabt.» Eines Abends sagte Grand, er habe das Adjektiv «elegant» für seine Amazone endgültig aufgegeben und bezeichne sie von nun an als «schlank». «Das ist anschaulicher», hatte er hinzugefügt. Ein andermal las er seinen beiden Zuhörern den so veränderten Satz vor: «An einem schönen Maimorgen ritt eine schlanke Amazone auf einer herrlichen Fuchsstute durch die blühenden Alleen des Bois de Boulogne.»
«Nicht wahr, man sieht sie besser», sagte Grand, «und ich habe ‹an einem Maimorgen› vorgezogen, weil ‹Morgen im Mai› den Trab etwas streckte.»
Danach zeigte er sich sehr besorgt wegen des Adjektivs «herrlich». Ihm zufolge war es nicht sprechend, und er suchte den Ausdruck, der die prachtvolle Stute, die er sich vorstellte, auf einen Schlag naturgetreu wiedergeben würde. ‹Wohlgenährt› ging nicht, das war zwar anschaulich, aber etwas herabsetzend. ‹Glänzend› hatte ihn einen Moment gereizt, aber es passte rhythmisch nicht. Eines Abends verkündete er triumphierend, er habe es gefunden: ‹Eine schwarze Fuchsstute.› Das ‹Schwarz› deute unauffällig die Eleganz an, wiederum ihm zufolge.
«Das geht nicht», sagte Rieux.
«Und warum nicht?»
«Fuchs bezeichnet nicht die Rasse, sondern die Farbe.»
«Welche Farbe?»
«Nun, jedenfalls eine Farbe, die nicht schwarz ist!»
Grand wirkte sehr betroffen.
«Danke», sagte er, «ein
Weitere Kostenlose Bücher