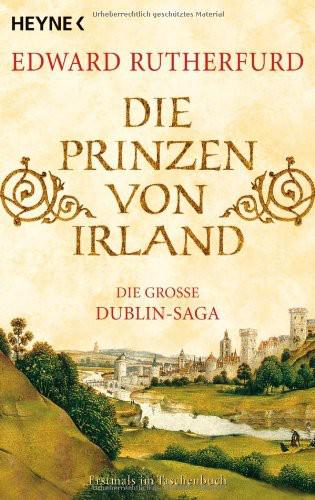![Die Prinzen Von Irland]()
Die Prinzen Von Irland
aus Ungeschick ein Fass von Vaters bestem Wein
zerschlagen hatte und dass über die Hälfte des Fasses ausgelaufen war. Ihr
Vater und ihre Brüder waren zum Glück nicht zu Hause, sonst hätte der Sklave sich
auf eine Auspeitschung gefasst machen können, aber sie verfluchte ihn gnadenlos
bei allen Göttern. Was sie noch mehr in Zorn gebracht hatte, war, dass der arme
Kerl, anstatt sich zu entschuldigen oder zumindest ein tief betrübtes Gesicht
zu machen, sobald er hörte, welche Götter sie anrief, auf die Knie gefallen
war, sich bekreuzigt und seine Gebete gebrabbelt hatte.
Insgesamt
betrachtet war die Anschaffung der zwei Sklaven von der Westküste Britanniens
einer der besseren Einfälle ihres Vaters gewesen. Fergus mochte alle möglichen
Fehler haben, aber wenn es um den Viehbestand oder menschliche Arbeitskraft
ging, besaß er einen ausgezeichneten Blick. Viele Briten von der Ostseite der
Nachbarinsel konnten, so hatte sie gehört, keine andere Sprache außer Latein
sprechen. Sie nahm an, dass dies nach jahrhundertelanger Römerherrschaft nicht
verwunderlich war. Aber die Briten von der Westküste sprachen zumeist eine
Sprache, die der ihren sehr ähnlich war. Der eine der Sklaven war groß und
stämmig, der andere kurz gewachsen; beide hatten dunkles Haar und waren als
Zeichen ihres Standes an Kinn und Wangen glatt bis auf die Haut rasiert. Sie
arbeiteten hart. Aber schon kurz nach ihrer Ankunft hatte Deirdre sie einmal
dabei überrascht, wie sie gemeinsam beteten. Sie hatten ihr erklärt, sie seien
Christen. Deirdre wusste zwar, dass viele Briten Christen waren, und sie hatte
sogar von kleinen christlichen Gemeinden hier auf der Insel gehört, aber sie
wusste nur wenig über diese Religion. Leicht besorgt hatte sie ihren Vater
gefragt, der sie jedoch beruhigte:
»Die
britischen Sklaven sind häufig Christen. Es ist eine Sklavenreligion. Lehrt
ihnen, dass sie untertänig und gehorsam sein sollen.«
Daher
hatte sie den stämmigen Sklaven weiter seine Gebete aufsagen lassen und hatte
sich ins Haus begeben – ein rundes Gebäude mit Wänden aus Lehm und
Weidengeflecht von etwa fünfzehn Fuß Durchmesser. Sein Licht erhielt es durch
die drei Eingänge, die offen standen, um die frische Morgenluft hereinzulassen.
In der Mitte des Raums befand sich ein Herd; Rauchschwaden des Herdfeuers
schwebten durch das Strohdach darüber in die Höhe. Neben dem Feuer stand ein
großer Kessel und auf einem niedrigen Holztisch eine Sammlung von Holzschalen –
denn im Gegensatz zu früheren Zeiten benutzte man auf der Insel nur noch selten
Töpferwaren.
Deirdre
saß eine Weile da und kämmte ihr Haar, das vom Regen verfilzt war. Hinter ihrer
häufigen Gereiztheit in letzter Zeit verbarg sich etwas, das ihr seit zwei
Monaten, seit ihrer Rückkehr vom Lughnasa–Fest, keine Ruhe ließ: ein hoch
gewachsener, blasser junger Prinz. Sie zuckte wegwerfend die Schultern. Es war
sinnlos, weiter an ihn zu denken.
Dann
hörte sie den närrischen Sklaven nach ihr rufen,
*
* *
Conall stand in
seinem Streitwagen und sah den Regenbogen über dem Meer. Zwei flinke Pferde
waren an die Mitteldeichsel geschirrt. An seinem Arm trug er eine schwere
bronzene Armspange. Wie es seinem Rang gebührte, befand sich in seinem Wagen
auch sein Speer, sein Schild und sein funkelndes Schwert. Sein Wagenlenker führte
die Zügel.
Was
hatte er eigentlich vor? Selbst als Dubh Linn und die Furt in Sicht kamen, war
sich Conall darüber noch nicht so recht im Klaren gewesen. Er war drauf und
dran gewesen, seinem Freund Finbarr an alledem die Schuld zu geben, hatte sich
aber gerade noch besonnen. Es war nicht Finbarrs Schuld. Es war diese junge
Frau mit ihrem goldenen Haar, ihren wundervollen Augen.
Conall
war noch nie verliebt gewesen. Er war zwar nicht unbeleckt von Erfahrung mit
Frauen – dafür hatte das Gefolge des Hochkönigs gesorgt. Natürlich hatte er
diese oder jene anziehend gefunden, aber wenn er sich eine Zeit lang mit einer
jungen Frau unterhielt, hatte er jedes Mal das Gefühl, als hätte sich eine
unsichtbare Schranke zwischen sie gesenkt. Die Frauen selbst bemerkten dies
nicht immer; wenn der hübsche Neffe des Hochkönigs zuweilen ein wenig
gedankenverloren oder melancholisch wirkte, fanden sie dies sogar attraktiv.
Aber ihn selbst stimmte es traurig, dass er seine Gedanken nicht mitteilen
konnte und dass die ihren immer so vorhersehbar waren.
»Du
erwartest einfach zu viel«, hatte Finbarr ihm unumwunden gesagt. »Du kannst von
einer
Weitere Kostenlose Bücher