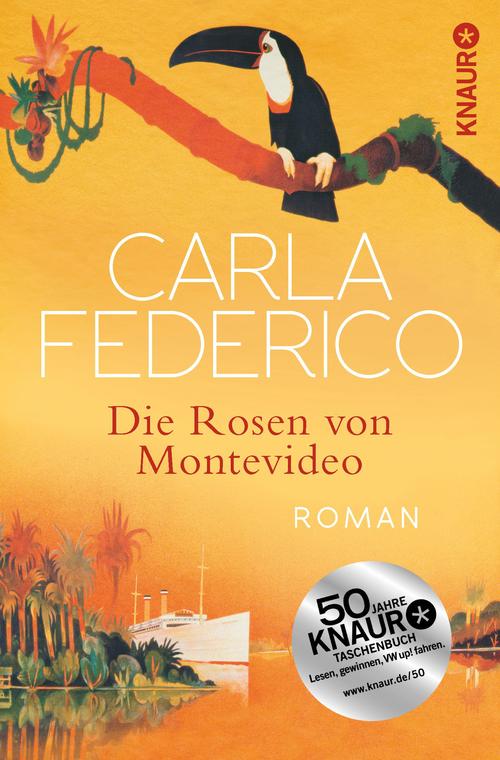![Die Rosen von Montevideo]()
Die Rosen von Montevideo
ihrem Gemach, denn sie wollte nicht, dass man sie weinen sah. Ihre Augen waren am Abend meist rot verquollen, und sie legte sich kühlende Tücher auf, damit sie Albert verborgen blieben.
Albert sah ohnehin nicht genau hin. Ohne Unterlass sprach er über seine Bankgeschäfte oder war in Gedanken versunken. Zunächst war sie erleichtert, später befremdet, wie blind er sich ihrem Kummer zeigte, war der doch nicht zuletzt davon bedingt, dass er sich keine Zeit mehr für sie nahm.
Ihr Heimweh verschwieg sie ihm – über die Langeweile aber klagte sie eines Tages ganz offen.
»Du könntest doch ausreiten«, schlug er einmal mehr vor.
»Bei diesem Regen?«
Er blickte zum Fenster und lauschte dem steten Prasseln so verwundert, als hörte er es zum ersten Mal. Rosa fühlte sich plötzlich tief gekränkt – wie konnte er von dem schlechten Wetter nichts mitbekommen? Und wie nicht erkennen, dass sie einsam war?
Sie floh vom gemeinsamen Abendessen, lief hoch ins Schlafzimmer und brach erneut in Tränen aus. Als Albert wenig später klopfte, rief sie wütend: »Ich will allein sein!«
Sie hörte, wie sich seine Schritte entfernten, und war tief enttäuscht. Sie wollte doch gar nicht allein sein, im Gegenteil, sie wollte sich an ihn schmiegen und wünschte sich, dass er ihr die Tränen vom Gesicht wischte.
Wenig später klopfte es wieder. Diesmal war es Espe, die Einlass begehrte und die sich nicht einfach fortschicken ließ.
Sie setzte sich zu ihr ans Bett und betrachtete Rosa nachdenklich. »Es wird nicht besser«, stellte sie fest, »nur immer schlimmer.«
Die Wahrheit so unumwunden ausgesprochen zu hören, entsetzte und erleichterte Rosa zugleich.
»Ja«, stieß sie hervor. »Der ständige Regen! Er macht mich noch verrückt. Ich weiß nicht, was ich während des ganzen Tages tun soll! Und Albert … Albert ist … mir so fremd.«
Sie biss sich auf die Lippen, denn sie klang schrecklich vorwurfsvoll, klang so wütend auf ihn … und auf sich selbst, weil sie ihn geheiratet hatte. Aber das war doch kein Fehler gewesen, das durfte keiner sein!
Espe strich ihr über den Kopf und stimmte ein Kinderlied in einer fremden Sprache – die der Indianer – an. Eine Weile tat es Rosa gut, zuzuhören, doch dann wurde es immer schmerzlicher. Sie zog den Kopf zurück. »Lass es gut sein.«
Espe schien zu begreifen, dass jeder Versuch, sie zu trösten, noch tiefer ins Herz schnitt. Sie zog sich wortlos zurück, und nachdem sie gegangen war, weinte Rosa weiter. Erst im Morgengrauen versiegten ihre Tränen, und sie schlief endlich ein.
Es war fast Mittag, als sie erwachte. Sie hatte Kopfschmerzen, ihre Glieder fühlten sich schwer und steif an. Der Regen hatte nachgelassen, aber der Himmel war immer noch grau. Vielleicht sollte sie wirklich einmal ausreiten …
Sonderlich groß war die Lust darauf nicht, trotzdem rief sie nach Espe, zwang sich, zu frühstücken, und kleidete sich an, ehe sie nach unten ging.
Bis dahin war ihr Wille stark gewesen, doch beim neuerlichen Anblick der Tapete fühlte sie sich wie gelähmt. Nein, sie konnte nicht ausreiten, konnte sich auch mit nichts anderem beschäftigen, konnte nur in ihrem Elend versinken. Sie griff nach dem erstbesten Gegenstand, der ihr in die Hände kam – eine Blumenvase – und schleuderte sie gegen die Wand. Das Klirren war laut und nicht minder leise ihr Entsetzensschrei. Noch befremdender als ihre Schwermut war diese Gier, etwas zu zerstören – nicht nur eine Vase oder die Tapete … sondern Albert … sich selbst.
Nie hatte sie sich vor sich selbst gefürchtet wie in diesem Augenblick, und zum ersten Mal brach sie nicht erst im Schlafzimmer in Tränen aus, sondern hier, wo jeder sie sehen konnte – und wo wenig später Antonie auf sie stieß.
Antonie Gothmann, geborene Morel, betrachtete Rosa eine Weile von der Türschwelle aus. Ein mitfühlendes Lächeln erschien auf ihren Lippen, denn sie hatte ihr Leben lang gelernt, ihre wahren Gefühle zu verbergen – ein Vermögen, das ihr nützlich erschien, das Rosa aber gänzlich fehlte. Als diese sie erblickte, wischte sie sich nicht etwa schnell die Tränen ab und suchte nach einer Ausrede, warum sie geweint hatte, sondern schluchzte noch heftiger.
Antonies Lächeln wurde breiter, aber ihre Augen wurden schmaler. Sie konnte die Verachtung, die in ihr hochstieg, beinahe schmecken – gallig und bitter und zäh. Auf dieser Welt gab es viel zu viele Frauen, die nicht still und heimlich heulten,
Weitere Kostenlose Bücher