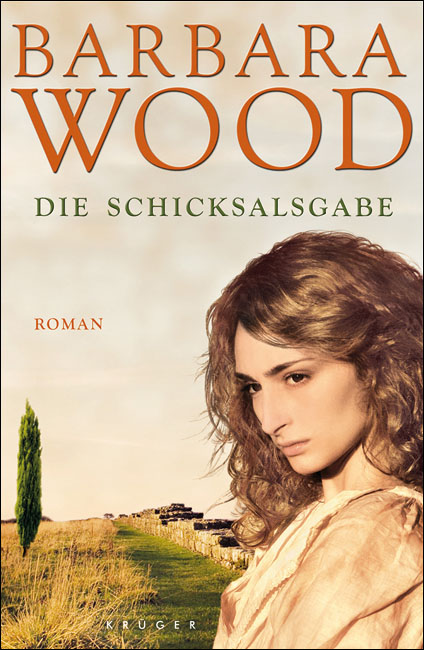![Die Schicksalsgabe]()
Die Schicksalsgabe
Sebastianus.
Ulrika ließ die blaue Palla von ihrem Kopf auf die Schultern gleiten, drehte sich langsam nach allen Seiten um, in der Hoffnung, sich an irgendetwas Markantes zu erinnern. Die mattfarbene Landschaft wirkte unversöhnlich und leblos. Was im Frühjahr geblüht hatte, war längst verdorrt. In der Ferne sah man den blassblauen Wasserstreifen des Salzmeers, in das der Jordan mündete. »Ich finde es schon noch, ganz bestimmt«, sagte sie.
Sebastianus musterte die trostlose Landschaft, das flache Tal und die von Höhlen durchzogenen steilen Felsen, richtete den Blick dann wieder auf seine Frau. Wie schön sie war, wie stark und entschlossen! Wie er sie liebte und bewunderte! Wie sie bei Daniels Burg durch ihre spirituelle Gabe so viele Menschen gerettet hatte!
Nachdem es alle in die von Ulrika entdeckten Gänge geschafft hatten und in Sicherheit waren, hatte Sebastianus den abgestemmten Gesteinsbrocken wieder an seine alte Stelle gerückt, sich dann dem Hohepriester gestellt und ihm erklärt, dass sich die Versammlung aufgelöst habe und die Bürger keinesfalls die Absicht gehabt hätten, Marduk zu kränken. Der Hohepriester hatte Sebastianus scharf angesehen und nur eine einzige Frage gestellt: »Beabsichtigst du, länger in Babylon zu verweilen?«
»Ich reise morgen nach Rom ab.«
Worauf der Hohepriester angesichts der verlassenen Zelte, der herumliegenden Essensreste und der noch flackernden Öllampen – Beweise für den überstürzten Aufbruch einer größeren Menschenmenge – nur noch gesagt hatte: »Marduk sieht alles. Er hofft, dass sein Volk wieder in den Tempel kommt und sich den Wohltaten seiner alles überragenden Macht erfreut. Gute Reise, Sebastianus Gallus.«
Zu Sebastianus’ Erleichterung hatten die Priester und Tempelwachen daraufhin kehrtgemacht und waren in Richtung Babylon abgezogen.
Würde die Erinnerung an Judah bewahrt werden? Ulrika hatte zwar alle in diesem Sinne beschworen, aber die Menschen brauchten nun mal Tempel und Götterbilder und Priester. Sebastianus dachte an den uralten Altar in seiner Heimat, an einem Ort, den die Römer Finisterre nannten – »das Ende der Welt.« Eine Ahnin namens Gaia hatte den Altar vor vielen hundert Jahren errichtet, und es hatte eine Zeit gegeben, da man von überall her gekommen war, um an diesem Altar der Göttin zu huldigen. Selbst aus dem fernen Gallien und dem Rheinland waren Pilger über die alten Straßen gezogen, um am Muschelaltar zu beten. Bis Banditen und Wegelagerer den wehrlosen Wanderern aufgelauert, sie ausgeraubt und sogar umgebracht hatten, weshalb Pilgerreisen zum Muschelaltar nach und nach unterblieben und Gaias Altar in Vergessenheit geriet.
Würde das Gleiche in Babylon passieren? Würde es den Priestern wie seinerzeit den Banditen gelingen, die Anhänger von Rabbi Judah so zu verschrecken, dass sie ihm letztendlich den Rücken kehrten?
Primo zog sein Schwert, erhob es zu einem schnell auszuführenden tödlichen Hieb. Aber da sprang die Frau auf, zog den Schleier von ihrem grauen Haar und sagte leise: »Ich flehe dich an, Herr, ziehe in Frieden. Ich bin keine Feindin Roms.«
Urplötzlich schwand die judäische Wüstenei, und die Vergangenheit kehrte zurück. Primo war wieder Soldat, befand sich wieder in dem kleinen Dorf in Galiläa, umzingelt von wütenden Männern, die drauf und dran waren, ihn in Stücke zu reißen. Es war nicht ihr Gesicht, das ihm bekannt vorkam, sondern ihre Stimme, ihr Dialekt, die Worte, die sie gebrauchte.
Er hielt den Atem an. Nein, das war nicht die junge Mutter aus dem Dorf, damals … Und ihr dennoch so ähnlich …
Primo war wie versteinert, gebannt von zwei dunklen, tränenfeuchten Augen. Eine Haarsträhne flatterte ihr über die Wange, und wie diese Haarsträhne flatterte in ihm eine Erinnerung auf: wie sich seine Mutter mit dem Kamm durch ihre vollen Flechten fuhr und er, ihr Sohn Fidus, ihr dabei zuschaute. Sie weinte. An ihren Schultern waren frische Blutergüsse zu erkennen. Der Kamm war aus Holz, ein paar Zähne fehlten. Fidus hätte ihr gern einen Kamm aus Elfenbein gekauft. Er hätte gern die Männer getötet, die sie missbrauchten.
Ein Zittern überlief ihn – nicht damals, als er neun Jahre alt war, sondern jetzt, in der judäischen Wüste –, als er sich bewusst wurde, dass seine Mutter einfach getan hatte, womit sie überleben konnte, und dass diese Frau namens Rachel jetzt ebenfalls nur daran dachte, nicht zu sterben. Seine Mutter, die nie eine Schule
Weitere Kostenlose Bücher