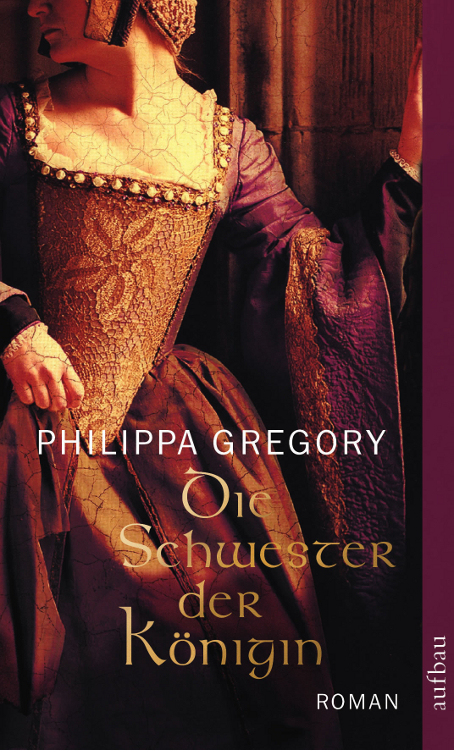![Die Schwester der Königin - Gregory, P: Schwester der Königin]()
Die Schwester der Königin - Gregory, P: Schwester der Königin
|7| Frühling 1521
Ich hörte gedämpften Trommelwirbel. Sehen konnte ich nichts außer der Schnürung am Mieder der Dame vor mir, die mir den Blick auf das Schafott versperrte. Ich war nun schon über ein Jahr am Hof und hatte Hunderte von Festlichkeiten miterlebt, aber noch keine wie diese.
Wenn ich ein wenig zur Seite trat und den Hals reckte, sah ich, wie der Verurteilte in Begleitung seines Priesters langsam vom Tower zu der Wiese schritt, wo die hölzerne Plattform wartete und mitten darauf der Holzblock. Der Scharfrichter trug schon die Kleidung seines Amtes, stand in Hemdsärmeln da, mit der schwarzen Kapuze über dem Kopf. Alles schien eher ein Maskenspiel als Wirklichkeit zu sein. Ich schaute zu, als würde ein Theaterstück für den Hof gegeben. Der König saß auf dem Thron und wirkte zerstreut, als ginge er im Kopf noch einmal die Rede durch, mit der er die Begnadigung verkünden würde. Hinter ihm standen mit ernster Miene William Cary, mein Ehemann seit einem Jahr, mein Bruder George und mein Vater, Sir Thomas Boleyn. Ich wackelte in meinen Seidenschuhen mit den Zehen und wünschte mir, der König würde sich beeilen und endlich seinen Gnadenerlaß aussprechen, damit wir alle frühstücken gehen konnten. Ich war erst dreizehn Jahre alt und hatte ständig Hunger.
Am anderen Ende des Holzgerüstes legte der Herzog von Buckinghamshire seinen dicken Umhang ab. Wir waren nah genug miteinander verwandt, daß ich ihn Onkel nennen durfte. Er war zu meiner Hochzeit gekommen und hatte mir ein goldenes Armband geschenkt. Mein Vater erklärte mir, er hätte den König auf ein Dutzend verschiedene Arten beleidigt: In seinen Adern floß königliches Blut, und er hielt sich ein viel zu großes Gefolge, als daß es einem König gefallen |8| konnte, der sich seines Throns noch nicht vollkommen sicher war. Am schlimmsten aber war, daß er angeblich gesagt hatte, der König habe bis jetzt keinen Sohn und Erben, würde auch sicher keinen mehr bekommen und wahrscheinlich ohne männlichen Thronfolger sterben.
Derlei Gedanken durfte man nicht laut äußern. Der König, der Hof, das ganze Land wußten, daß die Königin unbedingt einem Sohn das Leben schenken mußte, und zwar bald. Etwas anderes auch nur anzudeuten, das war der erste Schritt auf dem Pfad, der zu den hölzernen Stufen des Schafotts führte, die mein Onkel, der Herzog, jetzt gerade furchtlos und mit festen Schritten hinaufstieg. Ein guter Höfling spricht niemals unbequeme Wahrheiten an. Bei Hof hatte man stets fröhlich zu sein.
Onkel Stafford trat vorne an die Plattform, um ein paar letzte Worte zu sprechen. Ich war zu weit weg, um sie hören zu können. Ich hatte ohnehin nur Augen für den König, der sicherlich auf das Stichwort wartete, um endlich vorzutreten und den königlichen Gnadenerlaß zu geben. Dieser Mann, der da im Sonnenlicht des frühen Morgens auf dem Schafott stand, hatte gegen den König Tennis gespielt, war in Turnieren gegen ihn geritten, war sein Kumpan bei Hunderten von Trinkgelagen und Glücksspielen gewesen. Seit ihrer Kinderzeit waren die beiden Freunde. Der König wollte ihm gewiß nur eine Lektion erteilen, eine eindrucksvolle öffentliche Lektion, und dann würde er ihn begnadigen, und wir konnten alle frühstücken gehen.
Die kleine, ferne Gestalt des Herzogs wandte sich jetzt dem Beichtvater zu. Er beugte den Kopf, um den Segen zu empfangen, und küßte den Rosenkranz. Er kniete sich vor den Block, umfaßte ihn mit beiden Händen. Ich fragte mich, wie es wohl sein mußte, die Wange an das glatte, gewachste Holz zu schmiegen. Selbst wenn er wußte, daß alles nur eine Maskerade war und nicht die Wirklichkeit, mußte es doch für meinen Onkel ein seltsames Gefühl sein, den Kopf auf den Block zu legen und zu wissen, daß hinter ihm der Scharfrichter stand.
Der Henker hob das Beil. Ich blickte zum König. Sein Einspruch |9| ließ sehr lange auf sich warten. Ich schaute auf das Gerüst zurück. Mein Onkel, den Kopf auf dem Block, breitete die Arme weit aus, als Zeichen der Zustimmung, als Zeichen, daß das Beil fallen konnte. Ich blickte wieder zum König, der jetzt sofort aufspringen mußte. Aber er saß immer noch da, das hübsche Antlitz zu einer grimmigen Miene verzerrt. Und während ich auf ihn blickte, erscholl ein weiterer Trommelwirbel, der plötzlich abbrach. Dann hörte man den dumpfen Schlag des Beils: einmal, dann noch einmal und ein drittes Mal. Das Geräusch klang heimelig und vertraut wie Holzhacken. Ungläubig
Weitere Kostenlose Bücher