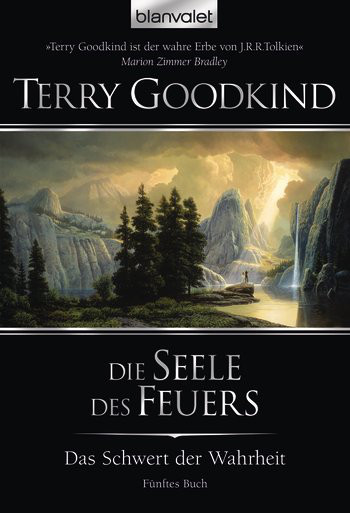![Die Seele des Feuers - 10]()
Die Seele des Feuers - 10
Dort bot sich das gleiche Bild: Menschen schrien, liefen durcheinander. Beata schirmte ihre Augen gegen die Sonne ab und blinzelte aus zusammengekniffenen Augen in die Ferne. Die Überreste zweier Soldaten lagen draußen vor ihrem Posten.
Estelle Ruffin und Corporal Marie Fauvel trafen bei Turners Überresten ein. Estelle fing, sich mit beiden Händen die Haare raufend, an zu schreien. Marie wandte sich ab und übergab sich.
Schuld daran war ihre Ausbildung. Schuld war die Art, wie bestimmte Dinge getan werden mussten. Angeblich wurde es seit Jahrtausenden schon so gemacht.
Jeder Trupp, von jeder Dominie Dirtch, sandte zur selben Zeit eine Patrouille aus, um das Gelände zu erkunden. Auf diese Weise konnte, was oder wer immer dort draußen gerade sein Unwesen trieb, nicht einfach dem einen Soldaten ausweichen und sich andernorts verstecken.
Nicht nur ihre, sondern sämtliche Dominie Dirtch entlang der Grenze waren von selbst erklungen.
Kahlan packte Richards Hemd; er war immer noch bewusstlos vor Schmerzen. Es gelang ihr nicht, ihn aus der zusammengekrümmten Haltung zu lösen, zu der er sich eingerollt hatte. Sie wusste nicht genau, was geschehen war, aber sie hatte eine Befürchtung.
Offensichtlich schwebte er in tödlicher Gefahr.
Sie hatte seinen Aufschrei gehört. Sie hatte gesehen, wie er vom Pferd gestürzt und auf dem Boden aufgeschlagen war. Nur wusste sie einfach nicht, warum.
Ihr erster Gedanke war: ein Pfeil. Die Vorstellung, der Pfeil eines gedungenen Mörders könnte ihn getötet haben, hatte ihr einen entsetzlichen Schrecken eingejagt, doch konnte sie kein Blut erkennen. Sie hatte ihre Gefühle ausgeschaltet, hatte nach Blut gesucht, aber bei einer ersten flüchtigen Untersuchung keines gefunden.
Kahlan sah auf, als eintausend d’Haranische Soldaten rings um sie ausschwärmten. Nach Richards Schrei und seinem Sturz vom Pferd waren sie augenblicklich und ohne ihren Befehl in Bewegung geraten. Im Nu wurden Schwerter aus ihren Scheiden gezogen, Äxte lösten sich aus den Gürtelhalterungen und landeten in angriffsbereiten Fäusten, Lanzen wurden gesenkt.
Im gesamten Umkreis hatten Männer ein Bein über den Hals ihres Pferdes geschwungen und waren, die Waffen kampfbereit in den Händen, zu Boden gesprungen. Andere Soldaten schlossen, den nächsten Schutzring bildend, die Reihen und wendeten ihre Pferde, bereit zum Sturmangriff nach außen. Wieder andere, der äußerste Rand der Einsatztruppe, waren davongestürmt, um die Angreifer ausfindig zu machen und das Gelände von allen Feinden zu säubern.
Kahlan hatte sich Zeit ihres Lebens im Umfeld von Armeen aufgehalten und kannte sich aus mit kämpfenden Truppen. An ihrer Reaktion erkannte sie, dass diese Männer so gut waren, wie man es sich nur wünschen konnte. Befehle waren nicht erforderlich gewesen; jedes Verteidigungsmanöver wurde erwartungsgemäß ausgeführt, und das schneller, als hätte sie die entsprechenden Befehle erteilt.
Über ihr und Richard bildeten die Baka Tau Mana, die Schwerter gezückt und kampfbereit, einen undurchdringlichen Schutzring. Worin der Angriff auch bestand, ob es ein Pfeil war, ein Wurfspeer oder etwas anderes, Kahlan konnte sich nicht vorstellen, dass ihre Beschützer den Angreifern ein weiteres Mal Gelegenheit geben würden, ihren Lord Rahl zu attackieren. Selbst wenn alles andere versagte, hatten sich inzwischen zu viele Männer in Ringen um sie geschart, als dass ein Pfeil noch hätte hindurchgelangen können.
Kahlan, ein wenig überwältigt von dem plötzlichen Durcheinander, erkannte mit einem Anflug von Besorgnis, dass Cara vielleicht verärgert sein könnte, weil sie zugelassen hatte, dass Richard etwas zugestoßen war. Schließlich hatte Kahlan versprochen, alles Unheil von ihm fern zu halten – als hätte sie das Cara extra versprechen müssen.
Du Chaillu bahnte sich einen Weg durch ihre Meister der Klinge und ging auf Richards anderer Seite in die Hocke. Sie hatte einen Wasserschlauch und ein Stück Stoff zum Verbinden der Wunde bei sich.
»Habt Ihr die Verletzung gefunden?«
»Nein«, antwortete Kahlan, an ihm herumsuchend.
Sie legte ihm eine Hand seitlich gegen das Gesicht und fühlte sich dabei an die Zeit erinnert, als er die Pest hatte und wegen des Fiebers nicht bei klarem Verstand war, nicht wusste, wo er sich befand. Eine Krankheit konnte er nicht haben, nicht so, wie er geschrien hatte und vom Pferd gestürzt war, trotzdem schien er vor Fieber zu glühen.
Du Chaillu tupfte Richard
Weitere Kostenlose Bücher