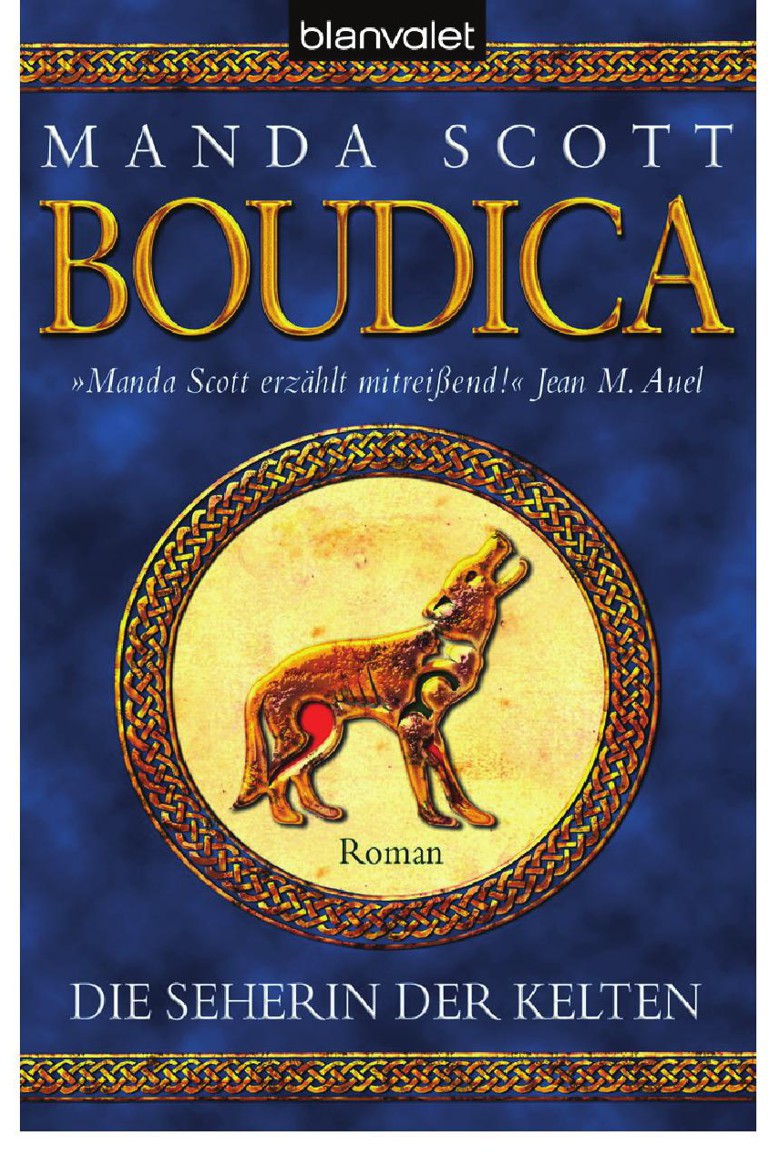![Die Seherin der Kelten]()
Die Seherin der Kelten
zu seinem Mund inne. »Ich nehme mal an, das ist Priscus’ Spiegel. Aber mal abgesehen davon, um meine Verletzungen zu bewundern, wozu sollte ich den brauchen?«
»Weil ich denke, dass du in letzter Zeit wohl keinen mehr zur Hand genommen hast. Komm näher an das Feuer heran und sieh, ob du überhaupt noch erkennst, was du siehst.«
Valerius hatte sich zum ersten Mal selbst gesehen, als er noch ein Kind gewesen war und der Händler Arosted einen silbernen Spiegel für Valerius’ Mutter mitgebracht hatte. Der Spiegel sollte den Visionen als Tor dienen, wie die meisten Spiegel, doch der dreijährige Bán hatte dennoch einen kurzen Blick hinein erhaschen können und war mit dem, was er gesehen hatte, recht zufrieden gewesen; er hatte nämlich große Ähnlichkeit mit seiner Mutter gehabt. Er dachte damals, seine Augen sähen genauso aus wie die ihren, und auch sein Haar war genauso schwarz gewesen, was gut so war, und selbst die Form seines Gesichts hatte dem seiner Mutter stärker geähnelt, als es bei seiner Schwester jemals der Fall gewesen war.
Noch Monate später hatte er sich seiner Mutter dadurch näher gefühlt, wenngleich der Spiegel schon längst wieder unter ihren geheimen Sachen versteckt worden war und er sein Spiegelbild nicht eher wiedergesehen hatte, bis er als Sklave in einer Villa in Gallien gearbeitet hatte. Diese Villa hatte einem Mann gehört, der berühmt gewesen war für seine Eitelkeit und dessen Wohnsitz wiederum Bekanntheit erlangte wegen der Anzahl und der Qualität seiner Spiegel, von denen allerdings keiner das Tor zu einer Vision gewesen war.
Damals war Valerius um ein Vielfaches gealtert, mehr als um die Summe seiner Jahre; er hatte sich zu oft gesehen, ohne sich eigentlich sehen zu wollen. Zu jener Zeit war er noch schlanker gewesen, und die scharfen Bögen seiner Wangenknochen waren durch die dunklen Ringe der Erschöpfung und der Verzweiflung unter seinen Augen nur noch stärker hervorgetreten. Und doch war noch eine Art Unschuld an ihm gewesen, so als ob er noch immer geglaubt hätte, dass die Götter und das Schicksal ihn letztendlich doch wieder mit Gnade behandeln würden.
Kaiser Claudius dagegen waren Spiegel nicht allzu lieb gewesen, und auch keinem der Gouverneure, der Gesandten oder der Tribune, unter denen Valerius gedient hatte. Als Valerius sich das nächste Mal gesehen hatte, war das in einer Taverne in Gallien gewesen, und allein an dem scharfen Schnitt seines Gesichts und dem bläulich schwarzen Ton seiner Haare hatte er den Mann erkannt, der ihm da aus dem schmierigen, schlecht polierten und von Schlieren überzogenen Metall entgegenstarrte. Damals hatte er bereits jede Unschuld verloren.
Und eindeutig hatte er sie noch immer nicht wiedererlangt. Priscus’ Spiegel war auch nicht schlechter als der in der Taverne, und seine Oberfläche war alles andere als eben, aber zumindest war er nicht von Fliegenkot beschmutzt. Valerius’ Augen blickten noch härter, als er sie in Erinnerung gehabt hatte; er erwartete eben nicht mehr länger, dass die Götter sein Leben schon noch richten würden. Die langsam dunkler werdenden Prellungen und Schwielen in seinem Gesicht machten es unmöglich, noch irgendetwas anderes zu erkennen, das darüber hinaus von Bedeutung hätte sein können.
Wieder einmal erkannte er den Mann, der ihm da aus der von Feuerglanz überzogenen Bronze entgegenstarrte, nur anhand der Farbe seines Haares, das noch ebenso bläulich schwarz und glatt war wie in seiner Kindheit. Valerius hatte immer gedacht, das wäre das Vermächtnis seiner Mutter an ihn gewesen; bis Luain mac Calma behauptet hatte, sein Vater zu sein.
Im Nachhinein musste Valerius zugeben, dass er Luain mac Calma in der Tat ähnlich sah, was, wenn es schon keine tiefere Bedeutung besaß, doch zumindest eine ganze Anzahl von bisher ungereimten Dingen erklärte, die sich in Valerius’ Vergangenheit ereignet hatten. Er reichte den Spiegel an Longinus zurück.
»Und was willst du mir damit nun sagen?«, fragte er.
»Ich will dir damit sagen, dass nur wir, die wir hier dieses Feuer mit dir teilen, dich kennen. Denn zehn ganze Jahre lang haben wir den Schmerz in deinen Augen gesehen, zehn Jahre lang haben wir darauf gewartet, dass deine scheinbare Gelassenheit endlich einmal aufbräche; wovor ein Mann sich einmal wirklich gefürchtet hat, das erkennt er stets wieder. Nur diejenigen von uns, die ihr halbes Leben unter den Peitschenhieben deiner Zunge verbracht haben, konnten also auch nur die
Weitere Kostenlose Bücher