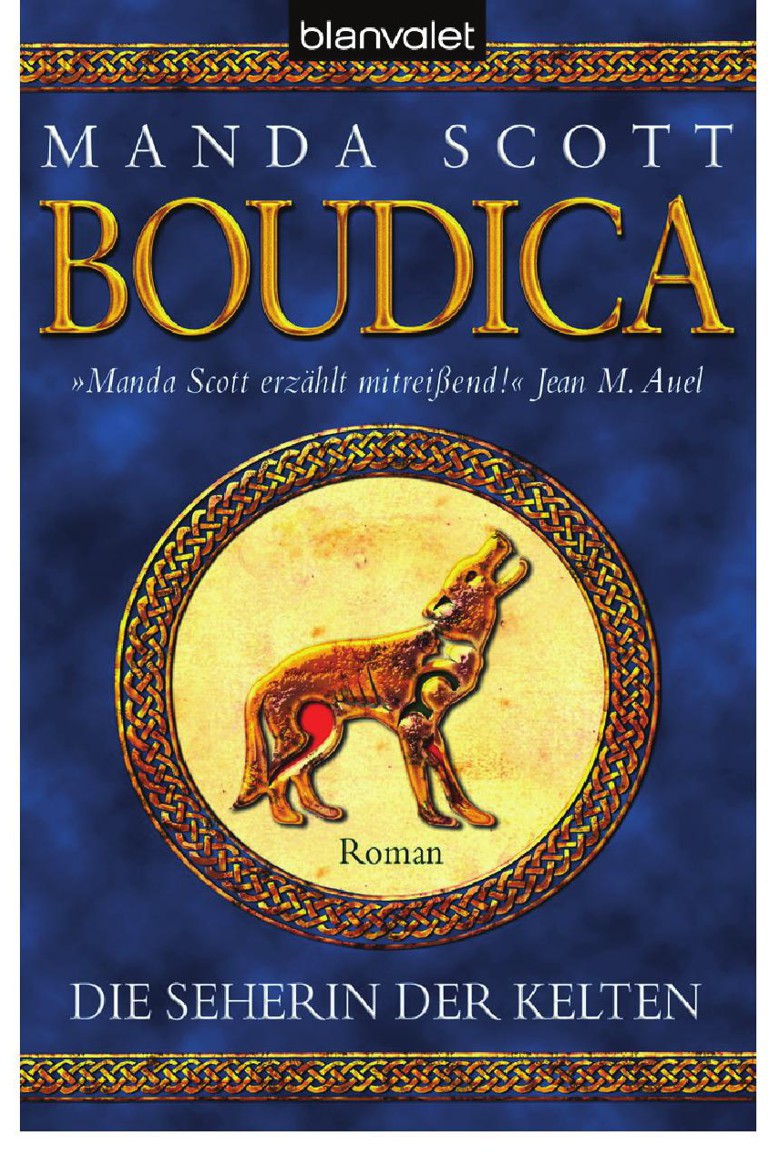![Die Seherin der Kelten]()
Die Seherin der Kelten
Seitenblick zu. In lateinischer Sprache entgegnete der Junge: »Ich bin ein Späher der Zwanzigsten Legion, stationiert in Camulodunum. Ich bin auf der Suche nach Corvus, dem Präfekten der Zwanzigsten...«
Valerius schüttelte den Kopf. »Falsch geraten«, entgegnete er mit sanfter Stimme und verstärkte den Druck auf seine Klinge noch ein wenig.
»...Bodicea...«
Der Name erklang nurmehr mit einem leisen Zischen, hervorgespien im Angesicht des Todes. Das Fleisch unter Valerius’ Hand begann zu zittern, und es war schwer, nun nicht bereits aus bloßem Instinkt zu töten. Dann aber stand plötzlich Longinus neben ihm und legte seinem Freund eine Hand auf die Schulter. »Warte.«
Doch weder der Name der Bodicea noch die Hand seines Freundes vermochten Valerius davon abzuhalten, den Späher zu töten. Was ihn letztlich doch daran hinderte, war der Anblick der Brosche, die am Umhang des Jungen steckte: eine silberne Brosche in der Form des Schlangenspeers mit drei schwarzen Wollsträngen, die vom unteren Bogen des Schmuckstücks herabbaumelten.
Valerius biss sich auf die Lippe und verringerte ein wenig den Druck auf das Messer. »Diese Brosche«, sagte er. »Wo hast du die her?«
»Die Tochter der... Bodicea.« Die Luftröhre des Spähers war bereits zu einem Teil durchtrennt. An der Schnittstelle trat schäumend Blut aus. »In meinen Händen... liegt das Leben des... Kindes der Bodicea.«
»Wie das?«
Die dunklen Augen schlossen sich, öffneten sich dann aber erneut. »Mein Leben für ihres. Deinen Eid darauf«, erklang sein Flüstern unter einem blutroten Sprühnebel.
Valerius lachte. Er ließ das Messer ein Stück weiter hinaufgleiten, bis es schließlich dicht an der Unterlippe des Fährtenlesers lag. Verzweifelt versuchte dieser, sich zu wehren, doch vergeblich, denn Valerius presste unterdessen bereits mit seiner freien Hand gegen den Hinterkopf des Jungen und zwang ihn damit langsam immer weiter nach unten, bis die Spitze seines Messers auf den festen Widerstand des Kieferknochens stieß. Durch zusammengebissene Zähne stöhnte der Späher auf, ganz so, wie auch die Ministranten Mithras’ stöhnten, wenn sie ihr erstes Brandmal empfingen.
Blut strömte über Valerius’ Handrücken. »Du bist noch nicht allzu lange bei den Legionen, nicht wahr?«, fragte er. »Und übrigens, wer das Messer hält, der bekommt auch die Informationen. Ich denke also, du wirst uns auch antworten, ohne dass ich dir dafür als Gegenleistung einen Schwur leisten muss.«
»Niemals...« Die Pupillen des Jungen weiteten sich. Und seltsamerweise schien in seinen Augen ein Hauch von Belustigung zu liegen. »Wenn ich sterbe, stirbt auch sie. Aber ihr Tod... wird schlimmer sein.«
Allein wegen dieser Unverschämtheit hätte Valerius ihn jetzt am liebsten getötet, wäre nicht plötzlich der Hund erschienen und hätte dem Späher das Blut von der Lippe geleckt; der Junge zuckte zurück, deutlich energischer, als er vor dem Messer zurückgewichen war, und auf seinem Gesicht erschien ein Ausdruck blanken Entsetzens.
Leise murmelte Longinus: »Valerius, er kann deinen Hund sehen.«
»Das habe ich auch bemerkt.« Valerius zog seine Hand wieder zurück. Sein Messer schwebte jetzt auf einer Höhe mit den Augen des Jungen. Und genau wie das Messer des Spähers, so war auch dieses hier deutlich länger als erlaubt und besaß eine doppelt geschliffene Schneide, ganz ähnlich jenen Häutemessern, welche die Träumer benutzten, wenn sie aus jemandem die Wahrheit herauszukitzeln gedachten. Auch dies entging dem Jungen keineswegs, und es ängstigte ihn fast ebenso sehr wie der Hund.
»Ich merke es, wenn du mich anlügst«, sagte Valerius. »Glaubst du mir das?«
»Ja.«
Damit zerrten Valerius und Longinus den Jungen hoch und fesselten ihn an den Handgelenken und Füßen. Von seiner Kehle floss kein Blut mehr herab, seine Unterlippe jedoch war an jener Stelle, wo Valerius sie eingeritzt hatte und sich unter der Oberfläche das Blut gesammelt hatte, auf die Dicke eines Katapultsteins angeschwollen.
Dann kniete Valerius sich vor den Jungen und richtete das Messer auf ihn. »Und jetzt erzähl!«
Schnell wie Pfeile trieb eine aus Osten heraufziehende Brise die Reiherwolken über den Himmel.
Breaca konnte sie nicht sehen, sie konnte sie nur spüren, als ob diese, angefüllt von den mit dem Wind reisenden Erinnerungen, ihre Flügel nach ihr ausstreckten.
Aber es waren nur Erinnerungen; nichts Reales, nichts Sichtbares. Denn bereits seit
Weitere Kostenlose Bücher