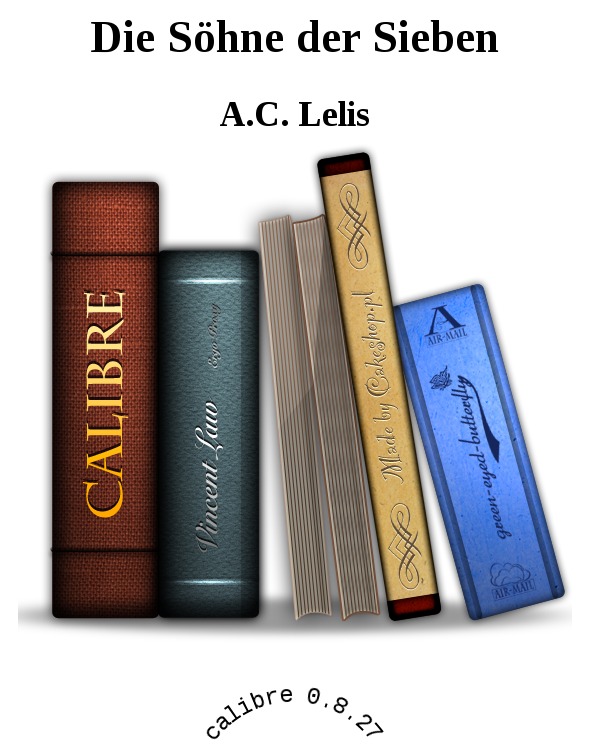![Die Söhne der Sieben]()
Die Söhne der Sieben
Ich spürte seine Lenden an meiner Haut. Vor allem aber spürte ich ihn in mir. Das pochende Geschlecht ließ mich schier den Verstand verlieren.
„Du stöhnst ja gar nicht“, stellte Leonard keuchend fest. „Oder hat es dir die Sprache verschlagen?“
„Ich sagte, dafür musst du dich anstrengen“, ächzte ich und hatte Schwierigkeiten das Zittern meiner Beine zu unterdrücken. Der dunkle Dämon merkte es und hob sie sich auf die breiten Schultern. Er kam noch tiefer und ich schnappte japsend nach Luft.
„Verdammt“, stöhnte ich verklärt auf und schloss die Augen.
Ein leises Lachen ertönte, jedoch nicht für lang. Dann kehrten seine Hände an mein Becken zurück und er begann sich langsam in mir zu bewegen. Meine Hände ballten sich zu Fäusten. Langsam und stetig begann Leonard in mich zu dringen und wieder zurückzuweichen. Es war unbeschreiblich was er damit in mir anrichtete. Seine Bewegungen wurde ausholender, gemeiner … besser. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich die Töne, die aus meiner Kehle drangen nicht unterdrücken können. Ich hatte vergessen, wer er war, wer ich war. Es existierte nicht mehr viel in meinen Gedanken, außer dieser heiße Pflock in mir und die Erregung, die er in mir zum Kochen brachte.
Schließlich kam ich ein zweites Mal und es war nicht vergleichbar mit dem vorherigen Mal. Ich brauchte Minuten, um wieder zu mir zu kommen und zu realisieren, dass es vorbei war. Sein warmes Sperma lief aus meinem geweiteten Anus. Auch Leonard schien noch fern von der Realität zu sein. Er lag neben mir, halb auf mir und klemmte meinen Arm unter seinem Gewicht fast schmerzhaft ein. Es störte mich dennoch nicht zu sehr. Sein Gesicht lag etwa auf der gleichen Höhe wie das Meinige. Es war Schweiß überströmt, aber auch sehr entspannt. Die Augen waren geschlossen und sein Atem hatte sich bereits beruhigt und drang tief und gleichmäßig aus seiner Nase. Er sah wirklich gut aus. Aber er war immer noch Teil der Fliegenbrut. Mein Feind. Jemand der mich hierzu gezwungen hatte.
„Mach mich los“, bat ich geschwächt. Ein unwilliges Grummeln kam von ihm, ehe er langsam die Augen öffnete. Sein Blick war klar. Er seufzte und streckte sich dann genüsslich: „Nein.“
„Warum nicht, du hattest doch was du wolltest“, empörte ich mich etwas.
Er lächelte verschmitzt. „Ich bin aber noch nicht satt.“
Natürlich nicht. Er war maßlos. In dieser Nacht nahm er mich noch drei weitere Male. Am Morgen, als wir aus einem gemeinsamen ohnmachtsähnlichen Schlaf erwachten, verging er sich ein weiteres Mal an mir. Diesmal so grob, dass ich wirklich mein Bewusstsein verlor. Ich erwachte im Reich meines Vaters. Immerhin hatte er mich in eine Decke gewickelt, so dass ich nicht ganz entblößt dalag, umringt von meinen besorgten Untertanen. Stöhnend richtete ich mich auf. Mir tat alles weh. Dennoch stiegen nicht nur negative Gedanken in mir auf, als ich an die letzte Nacht zurückdachte.
Die nächsten Tage verbrachte ich in meinem Teil der Behausung meines Vaters. Mir gehörte ein ganzer Turm, der sich an einen abgelegenen Trakt der Burg anschloss. Überall hatte ich meine Augen und niemand konnte hier eindringen, ohne dass ich sofort davon erfuhr. Hier konnte ich meine eigenen Männer befehligen und Schuldner empfangen, ohne dass mein Vater etwas davon erfuhr. Er würde die nächsten sieben Jahre ohnehin nicht allzu aufmerksam sein. Ich hatte inzwischen erfahren, was ihn so erzürnt hatte. Immer noch brannte eine eisige Wut in mir, wenn ich daran dachte, dass ich mich deshalb in Beelzebubs Schloss und Leonards Arme begeben hatte müssen. Mein alter Herr war einem kleinen Gör verfallen. Dem Jüngsten der Fliegenbrut. Ich hatte ihn flüchtig gesehen: Ein ganz liebreizender Bengel. Jedoch konnte ich wirklich nicht verstehen, wie mein Vater wegen ihm den Kopf hatte verlieren können.
Meine Spione hatten mir alles berichtet. Ich wusste von dem Urteil und Beelzebubs Frevel seinen Jüngsten vor der Mündigkeit eingesetzt zu haben. Es kam mir furchtbar dumm vor, zumal er wirklich genug mündige Söhne hatte. Dumm war es auch gewesen, mich in sein Schloss zu begeben. Ich hatte mir vorgenommen nie wieder diesen Fehler zu begehen. Außer wenn ich meine Wachen dabei hatte. Die ließ ich ohnehin nicht mehr aus meiner Reichweite. Noch nie hatte ich so viele Söldner beschäftigt. Es lag daran, dass ich nun wusste, dass Geist allein nicht ausreichte. Ich brauchte mehr Macht, als ich durch ihn und mein
Weitere Kostenlose Bücher