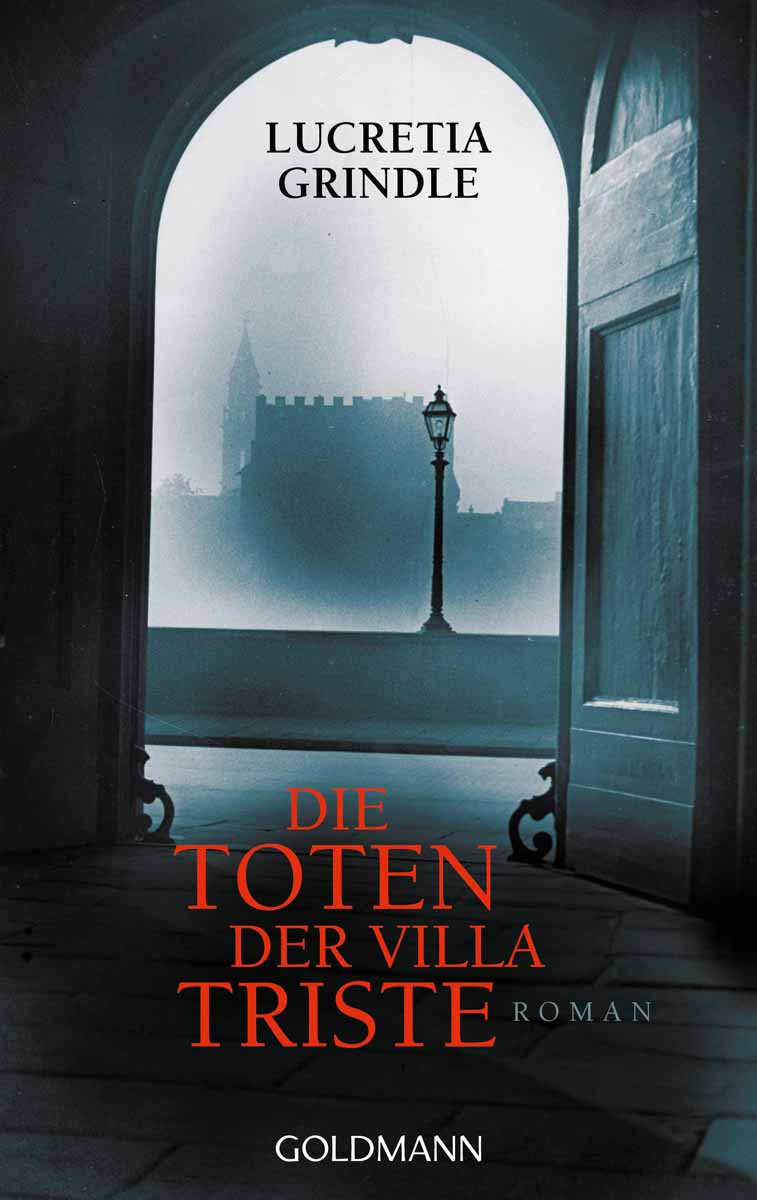![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
anders, sie hielt ihren Kopf anders. Sie hatte sich in jemand anderen verwandelt. Wenn ich es mir jetzt überlege, wird mir klar, dass mich das eigentlich nicht hätte überraschen dürfen. Zum einen war das unser gemeinsames Talent. Wir waren alle gut im Theaterspielen, aber Issa und ich, wir waren darin ungeschlagen. Papa gewann gewöhnlich beim Kartenspiel, und Rico konnte schneller laufen als wir, aber wir beide waren schon immer unübertroffen darin gewesen, jemanden darzustellen, der wir nicht waren.
Sie legte ihre Hand auf meine, und kaum hörte ich ihre Stimme – das Einzige, was sie nicht verändert hatte –, wusste ich, dass etwas passiert war. Anfangs dachte ich, es ginge um ihren Arm. Ich wollte ihre Wange streicheln, um festzustellen, ob sie fiebrig war, aber ihre Haut war kühl. Dann sackte mein Magen grässlich ins Leere. Mama? Papa? Hatten sie JULIA entdeckt? Sie bemerkte meine entsetzte Miene und schüttelte den Kopf.
»Lass uns in dein Kämmerchen gehen«, sagte sie und lächelte über den Namen für mein kleines Büro.
Als wir die Tür geschlossen hatten, bestand ich darauf, ihren Verband zu wechseln. Anschließend gab sie keine Ruhe, bis ich mich neben sie auf die Pritsche setzte, und was sie dann sagte, ließ meine Eingeweide rebellieren.
Issa bestand darauf, dass wir uns darüber unterhalten mussten, was passieren würde, wenn einer von uns »verschwand«.
Ich starrte sie an, ich klappte den Mund auf und versuchte, so viel Luft wie möglich einzuatmen, um den plötzlichen Druck in meinem Bauch zu verdrängen.
»Ich werde dich holen kommen«, sagte sie. »Was auch passiert. Ich werde dich holen kommen.«
»Red keinen Unfug!« Die Angst schärfte meine Stimme. »Das kannst du nicht. Niemand ›holt‹ jemanden aus der Villa Triste.«
Sie nickte. »Ich weiß. Ich weiß. Aber sie behalten dich nicht dort. Sie werden dich verhören, und dann schicken sie dich ins Frauengefängnis in San Verdiana. Die Oberin steht auf unserer Seite.«
Sie erklärte mir, dass sie von österreichischen Deserteuren ein paar deutsche Uniformen gekauft hätten, dass schon mehrmals »deutsche Offiziere« in San Verdiana aufgetaucht seien, um »Gefangene zu verlegen«. Falls das nicht klappte, falls die Zeit nicht ausreichte, wussten sie, wo die Züge abfuhren. Sie wussten, wo sie auf dem Weg zu den Gefangenenlagern und zum Deportationslager in Fossoli anhielten.
»Was auch passiert«, sagte sie. »Ich werde dich nicht vergessen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Vergiss das nie.«
Die GAP, behauptete sie, würden sich um ihre Leute kümmern.
Dann erklärte sie mir, dass für mich andere Regeln gälten. Dass ich auf keinen Fall etwas unternehmen dürfte, wenn es sie träfe – wenn sie verschwinden sollte.
Ich starrte sie an, aber noch bevor ich widersprechen konnte, redete sie weiter.
Ich müsse das verstehen. Falls ich zur Questura ginge, falls ich mich im Excelsior den Schwarzuniformierten an den Hals werfen würde, falls ich weinte oder bettelte, würde ich ihre Lage nur noch verschlimmern. Die GAP, behauptete sie, würden für sie sorgen, so oder so. Ich wollte mir lieber nicht ausmalen, was das bedeuten sollte. Falls sie sterben sollte, meinte Issa dann, würde jemand kommen und mich benachrichtigen.
»Ich habe Mama und Papa nichts davon gesagt.« Sie sah mich an. »Das geht nur uns beide an.«
Ich nickte, als sie das sagte. Nicht, weil ich einverstanden war, sondern weil ich mich wie betäubt fühlte. Meine winzige Kammer roch nach Kohl und unseren Körpern. Obwohl ich halb damit rechnete, dass meine Beine einknicken würden, stand ich auf und zog den Stuhl unter dem Schreibtisch heraus.
»Was tust du da?«, fragte Issa.
»Warte«, sagte ich. »Warte ab. Ich habe etwas …«
Halb schmunzelnd beobachtete sie, wie ich auf den Stuhl kletterte und in das oberste Schrankfach griff. Ich konnte nicht hineinsehen und fürchtete einen Moment lang, dass mir das Gesuchte auf den Kopf fallen würde. Dann ertasteten meine Finger den glatten, kühlen Flaschenhals und zogen den Branntwein heraus, den ich in meinem Rattenloch gehortet hatte.
Ich hatte ihn vor einem Monat einem fetten Schwarzmarkthändler mit Blinddarmentzündung aus dem Koffer gestohlen. Er war nicht gestorben – im Gegenteil, die Operation war ohne Komplikationen verlaufen, und er war längst wieder wohlauf –, aber das hatte mich nicht daran gehindert. Er hatte sein fettes kleines Faschistenabzeichen unübersehbar auf dem Mantelaufschlag
Weitere Kostenlose Bücher