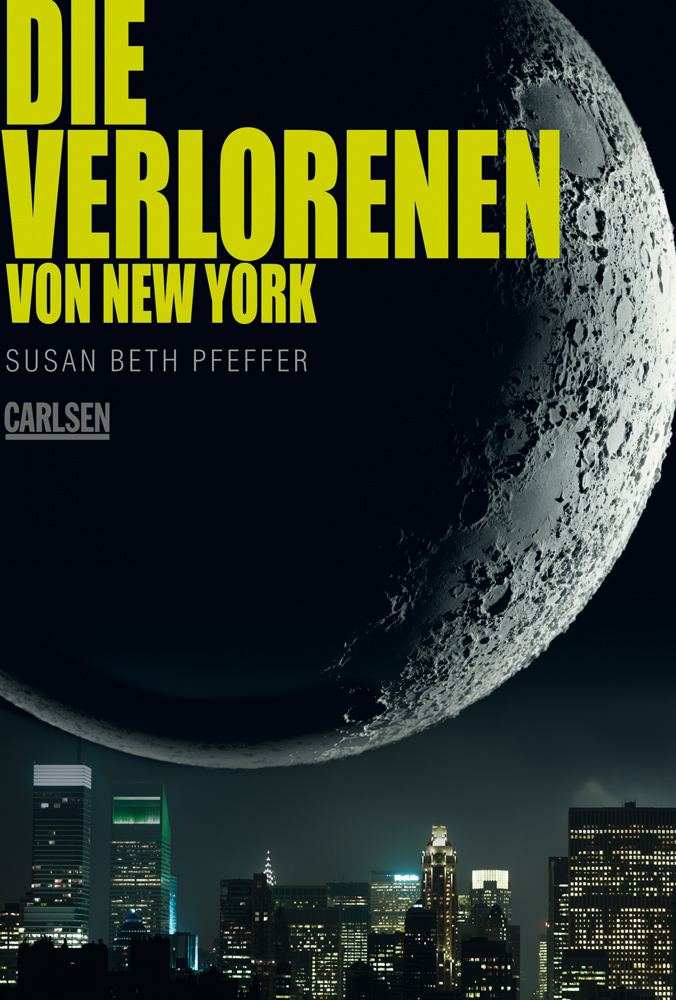![Die Verlorenen von New York]()
Die Verlorenen von New York
durchs Fenster zu schauen, dann sieht er den ganzen Kram.«
Daran hatte Alex noch gar nicht gedacht. Er musterte die Eisengitter vor den Fenstern – da kam so schnell keiner durch. Aber wenn jemand zum Äußersten entschlossen war, konnte er wahrscheinlich die Türen aufbrechen.
»Wir ziehen einfach die Vorhänge vor«, sagte er. »Hier fällt sowieso kaum noch Tageslicht rein. Oder wir hängen die Fenster mit Decken zu. So bleibt auch gleich die kalte Luft draußen. Ich hätte die Sachen lieber hier unten, wo wir sie im Blick haben.«
Julie holte die Mülltüten unter dem Spülbecken hervor. »Also dann«, sagte sie. »Was suchen wir genau?«
»Alles Mögliche«, erwiderte Alex. »Die Vorräte sind schon weg, aber es gibt sicher noch jede Menge Mäntel und Pullover und Schuhe. Wolldecken und Steppdecken. Taschenlampen, Kerzen, Batterien, Streichhölzer. Strümpfe. Alkohol. Alles aus den Arzneischränken. Was wir für uns nicht gebrauchen können, versuche ich einzutauschen. Wir müssen schnell sein, aber gründlich.«
»Meinst du, es wird alles noch schlimmer?«, fragte Julie, und Alex bemerkte die unterdrückte Panik in ihrer Stimme.
»Ja, ich glaube schon«, sagte Alex. »Auch wenn man sich das kaum vorstellen kann.«
»Ich möchte keine Ratten essen«, sagte Julie. »Oder tote Menschen.«
»Ich auch nicht«, sagte Alex. »Und damit wir das nicht müssen, gehen wir jetzt lieber mal an die Arbeit.«
Montag, 5 . September
»Julie!«, rief Alex, unfähig, den Ärger aus seiner Stimme herauszuhalten. »Guck dir bloß meine Hemden an! Nennst du das etwa sauber?« Er wusste, dass nichts und niemand mehr so sauber war wie früher, aber morgen fing die Schule offiziell wieder an, und da wollte er wenigstens halbwegs anständig aussehen.
»Dann wasch sie doch selber«, gab Julie zurück.
Alex packte sie am Arm. »So redest du nicht mit mir, ist das klar?«, sagte er. »Nie wieder.«
»Sonst …?«, fragte Julie.
»Sonst kriegst du nichts mehr zu essen«, sagte Alex.
Julie starrte ihn entsetzt an. »Das ist nicht dein Ernst, oder?«, fragte sie. »Dass du alles allein essen würdest?«
Alex wusste kaum noch, wie es sich anfühlte, keinen Hunger zu haben. Bri muss nicht hungern, dachte er. Die ist rund und rosig. Und wenn er Onkel Jimmy Julie hätte mitnehmen lassen, wäre sie vielleicht auch rund und rosig.
»Nein, war nicht so gemeint«, sagte er und ließ Julies Arm los. »Solange ich etwas zu essen habe, hast du das auch.«
»Mit der Hand kriegt man die Wäsche einfach nicht sauber«, sagte Julie. »Vielleicht sollte ich mal einen Tag lang zu Hause bleiben und die Waschmaschine anwerfen, sobald es Strom gibt.«
Alex schüttelte den Kopf. »Schule ist wichtiger«, sagte er. »Und von jetzt an wasche ich meine Sachen selber. Dann bin ich wenigstens auch selber schuld, wenn sie nicht sauber sind.«
»Papá hat nie Wäsche gewaschen«, sagte Julie.
»Kann sein, aber ich bin ja auch nicht Papá«, sagte Alex. Papá hätte niemals seiner Tochter damit gedroht, sie hungern zu lassen, egal, wie schmutzig seine Hemden gewesen wären.
Dienstag, 6 . September
Mit Erleichterung stellte Alex fest, dass zumindest einige seiner Mitschüler nach den Sommerferien in die Schule zurückgekehrt waren. Während der Messe hatte er durchgezählt, und seiner Schätzung nach war die Kapelle ungefähr zu einem Drittel gefüllt – gar nicht so schlecht, wenn man bedachte, dass keine neuen Siebtklässler hinzugekommen waren.
Pater Mulrooney hieß alle willkommen und erklärte, dass auch in diesem Jahr die Teilnahme an der Messe Pflicht sei. Das Kollegium hatte sich um zwei nervös wirkende Seminaristen vergrößert, zur Unterstützung der drei Priester, die während des Sommers die Stellung gehalten hatten. Mr Kim würde die naturwissenschaftlichen Kurse übernehmen und Mr Bello Mathematik. Das Mittagessen war an keinerlei Bedingungen mehr gebunden; wer am Unterricht teilnahm, bekam zu essen. Alex war erleichtert. Die Besuche bei den Leuten auf seiner Liste waren immer schwieriger und deprimierender geworden. Die körperliche Anstrengung, auch wenn er sich das nur ungern eingestand, machte ihm zunehmend zu schaffen – sei es, weil er so wenig aß, sei es, weil die Luft so schlecht war.
Und auch wenn er diesen Gedanken gern verdrängte, so waren mit Sicherheit einige der Leute, die er den Sommer über betreut hatte, an ebendieser miserablen Ernährung und Luftqualität gestorben.
Beim Mittagessen saß er mit Kevin, Tony
Weitere Kostenlose Bücher