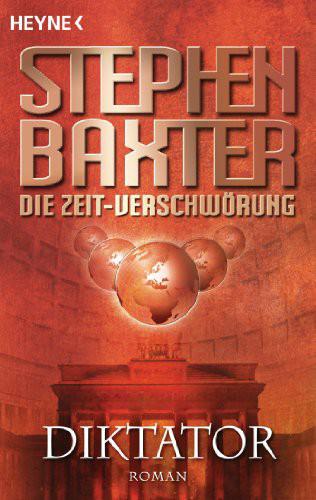![Diktator]()
Diktator
wahr?«
Hilda sah erneut ihren Vater an. »Dad? Was ist mit dir?«
Georges Gesicht war hart. »Na ja, ihr habt mir in der Sache keine große Wahl gelassen, oder? Gary, du bist ein guter Junge, das sieht jeder. Aber Hilda – der Ring deiner Mutter … und du hast es mir nicht mal erzählt!«
Hildas Gesicht war starr. »Ja, eben darum. Weil ich wusste, wie du reagieren würdest.«
Als sich die Stimmung verschlechterte, wich Ben bestürzt zurück.
In der Diele klingelte das Telefon. George fuhr zusammen. Es war erst vor ein paar Wochen installiert worden, für seinen Job; zuvor hatte er kein Telefon besessen. »Entschuldigt mich.« Er ging steifbeinig hinaus und zog sich dabei in seine Rolle zurück, mehr Uniform als Mensch.
»Er beruhigt sich schon wieder«, meinte Mary.
»Ja«, sagte Ben. »Es ist einfach ein Schock, das ist alles. Ich bin jedenfalls schockiert.«
Gary grinste. »Wir werden was dagegen unternehmen, wenn wir Zeit dazu haben – nach dem Krieg, falls wir so lange warten müssen. Wir geben einen Empfang – und vielleicht lassen wir uns auch kirchlich
trauen, wenn wir einen braven Feldkaplan finden, der’s macht.«
»Bis dahin bist du ein Kriegsheld«, sagte Ben. »Ähm, glaubt ihr, ihr könntet einen jüdischen Trauzeugen ertragen?« Sein Gesichtsausdruck war schwer zu deuten, dachte Mary, so als gäbe er sich zu große Mühe, erfreut zu wirken. Sie wusste, dass er Gary nahestand; sie fragte sich, ob er irgendwie eifersüchtig war.
George kam ins Zimmer zurück. Sein Gesicht war grau; er sah alt aus. »Cromwell«, sagte er schlicht.
Ben zuckte zusammen. Hilda ergriff Garys Hand.
Mary fragte: »Was bedeutet das?«
»Es ist ein Codewort«, sagte Ben zu ihr. »Die Invasion.«
Mary brauchte einen Moment, um das zu verdauen. In diesen letzten Minuten hatte sie den Krieg irgendwie vergessen, und nun drängte er sich ihr wieder auf. »Ich dachte, die fände nicht statt«, hörte sie sich sagen. »Es sei zu spät im Jahr, wegen des Wetters. Die RAF und die Navy seien zu stark. Das haben sie auf BBC immer gesagt. Könnte es ein Irrtum sein?«
»Wir müssen weg von hier«, sagte Gary.
George sah seine Tochter an. »Hilda …«
»Später, Dad«, fauchte sie, immer noch zornig. »Ich glaube, du hast alles gesagt, was es momentan zu sagen gibt.« Und sie stolzierte hinaus. Gary umarmte seine Mutter rasch, dann eilte er Hilda nach. George und Ben folgten ihnen.
Nur Mary hatte keinen Posten zu bemannen, keine offensichtliche Pflicht zu erfüllen, nirgendwohin zu
gehen. Sie stand in dem leeren Zimmer und staunte darüber, wie ihre ganze Welt von einem einzigen Wort auf den Kopf gestellt werden konnte.
Sie hielt immer noch die Postkarte in der Hand. Sie war zerknickt, als sie Gary umarmt hatte. Mary drehte sie benommen um. Sie kam von Doris Keeler, der jungen ARP-Wartin, die während des Luftangriffs im August so freundlich zu ihr gewesen war. Seither waren sie durch Karten und ein paar Briefe in Verbindung geblieben und hatten einander von ihren Erlebnissen berichtet. Nun, so las Mary, hatte Doris einen Brief vom Hauptquartier des Children Overseas Reception Board bekommen. Am Dienstagabend war die SS City of Benares , die Flüchtlingskinder nach Nordamerika brachte, torpediert worden. »Verzeihen Sie mir, dass ich einfach aus heiterem Himmel schreibe, wie man so sagt, mit einem solch schrecklichen Schock, und ich weiß, Sie haben Jenny gar nicht gekannt, aber ich schreibe, um es allen mitzuteilen, die mir einfallen …« Mary stellte sie sich vor, allein in ihrem Zuhause, ohne ihren in Kriegsgefangenschaft geratenen Mann und ihr verlorenes Kind, wie besessen eine Karte nach der anderen schreibend.
Irgendwo begann eine Kirchenglocke zu läuten, die erste Kirchenglocke, die Mary seit Monaten in England gehört hatte. Und dann keuchte eine Luftschutzsirene und heulte los.
X
Ernst saß zusammen mit vielen anderen Männern, allesamt Angehörige der Sechsundzwanzigsten Division der Neunten Armee, auf der Straße oberhalb der Hafenmauer von Boulogne. Sein Tornister hing ihm schwer am Rücken, und das auf Hochglanz polierte Gewehr schimmerte in seinen Händen. Die Männer saßen herum, rauchten trübsinnig, beklagten sich über ihre Offiziere, tauschten Geschichten über französische Frauen und französischen Wein aus und pflegten ihre Füße – sie taten, was Soldaten immer taten. Ernsts Wehrmachtsuniform war gewaschen und gebügelt; er hatte sich richtiggehend herausgeputzt für England. Die
Weitere Kostenlose Bücher