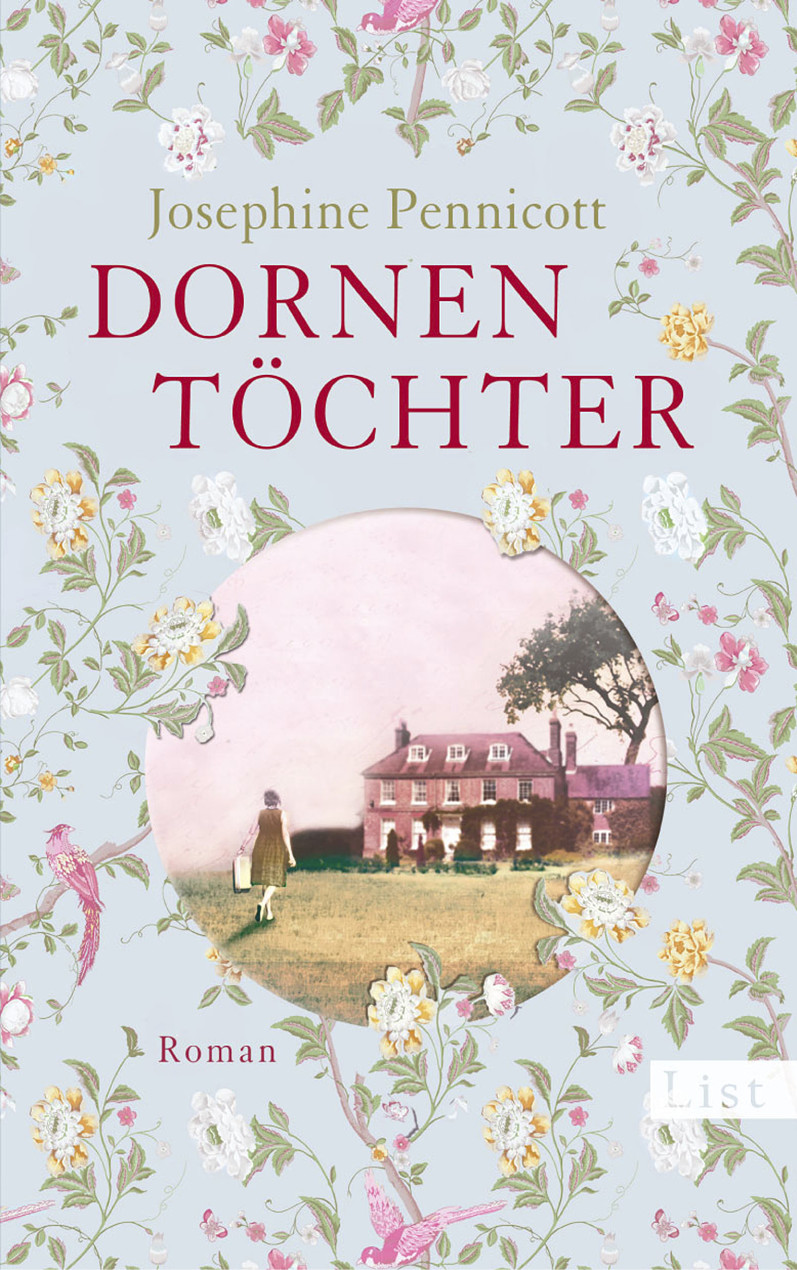![Dornentöchter]()
Dornentöchter
schämte mich fast ein wenig für ihn, denn wir waren es nicht gewöhnt, dass Männer sich so gehenließen. Maxwell jedoch, wie später alle betonten, war immer schon anders gewesen, ein bisschen weicher als die meisten Männer in Pencubitt. Sensibel und einfach zu gutherzig, meinten die meisten.
Marguerite, das arme Lämmchen, war blass. Sie zitterte und hielt sich in ihrem Kummer an Maxwell fest. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft es sein musste, in solch zartem Alter die Mutter zu verlieren.
Im Gegensatz dazu war Thomasina stumm und weinte auch nicht. Es hätte mich auch überrascht, wenn sie irgendein anderes Verhalten an den Tag gelegt hätte. Damals wusste man so wenig über Schockzustände, und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass das Kind therapeutische Hilfe bräuchte. Thomasina hatte den Mord zwar miterlebt, doch niemand wurde aus ihrem Bericht schlau. Sie faselte immer wieder davon, sie hätte gesehen, wie der Teufel, den sie im Keller hielten, ihre Mutter gefressen hätte. Während des gesamten Gottesdienstes war sie unruhig, hüpfte von einem Bein aufs andere und sah sich mit dem Anflug eines seltsamen Lächelns auf den Lippen um, als erheiterte es sie, dass ihre Mutter in dem weißen, mit Rosen bedeckten Sarg vorne in der Kirche lag. Ich war immer überzeugt davon, dass Thomasina ihre Mutter hasste. Vielleicht war es gerechtfertigt. Gleichzeitig war sie jedoch ein höchst seltsames und wenig liebenswertes Kind, das sich zu einer ebenso schwierigen jungen Frau entwickelte. Sie lehnte es ab, sich für dieses Buch interviewen zu lassen, wobei sie mir einen ziemlich obszönen Brief voll paranoidem Gefasel und schockierenden Äußerungen schickte. Thomasina hatte vielleicht nicht die Schönheit ihrer Mutter geerbt, doch sie legte einige der eher negativen Aspekte ihrer Persönlichkeit an den Tag.
Father Kelly kam während der Predigt mehrmals ins Stolpern. Er erklärte Mutter später, die Nerven wären mit ihm durchgegangen und er hätte sich nicht imstande gesehen, Gott angemessen seinen Dienst zu erweisen. Er war an solche Menschenmengen einfach nicht gewöhnt. Ich vermute, dass möglicherweise auch ihn die Gefühle überwältigten, zumal er doch ein heimliches Verlangen nach Pearl verspürt hatte. Vielleicht hatte er sie sogar auf seine Weise geliebt. Nachdem er sie begraben hatte, war er nie wieder derselbe und fing bald darauf an, in der Öffentlichkeit zu trinken.
Ich war bereits auf mehreren Beerdigungen in Pencubitt gewesen, aber nie auf einer, die in ganz Australien für Aufsehen sorgte. Die Journalisten benahmen sich schändlich. Einige Leute schrieben hinterher an die Zeitungen und beschwerten sich über die respektlosen Rufe in Maxwells Richtung, er solle »doch mal hierher schauen, Sir«, während die Fotoapparate der Reporter blitzten und sie Trauergäste mit den Ellbogen aus dem Weg schoben, um eine bessere Sicht auf die beiden kleinen Mädchen zu bekommen. Schönheit weckt immer Interesse, aber Schönheit, die vor ihrer Zeit ausgelöscht wurde, treibt zu ungebührlichem, sensationslüsternem Verhalten an. Bei all dem Aufruhr hätte man meinen können, Pearl wäre Olive Thomas.
Während ich zitternd in meinem schwarzen Mantel, mit Handschuhen und Hut dastand, schoss mir auf einmal der Gedanke durch den Kopf, dass Pearl die ganze Dramatik und Aufmerksamkeit genossen hätte. Sie hätte sich für die Fotografen mit einem spöttischen Lächeln auf ihrem elfengleichen Gesicht in Pose geworfen. Den Moment ihrer größten Berühmtheit zu genießen war ihr verwehrt.
Pearl wäre entsetzt gewesen, zu sehen, dass ihr alter Widersacher Edgar Cabret, der Illustrator ihrer Bücher, die Reise von Sydney hierher auf sich genommen hatte, um ihrer Beerdigung beizuwohnen. Er wurde von einem anderen Herrn begleitet, der, wie ich später erfuhr, ihr Verleger war. Edgars auffälliger Kleidungsstil zog einige Aufmerksamkeit auf sich: In seinem schwarzen Smoking, mit der großen Taschenuhr, die er sich an die Weste gesteckt hatte, gab er einen richtigen Dandy ab. Er hatte langes silbergraues Haar und einen ebensolchen Bart sowie einen Spazierstock mit einem geschnitzten Kenny-Kookaburra-Kopf als Knauf. Besonders belustigte mich die goldfarbene Fliege, die er trug – im Lauf der Jahre das Objekt vieler Auseinandersetzungen mit Pearl. Es war jedoch höchst freundlich von diesem angesehenen Künstler, so weit in unsere kleine Küstenstadt zu reisen, um Pearl die letzte Ehre zu erweisen. Es
Weitere Kostenlose Bücher