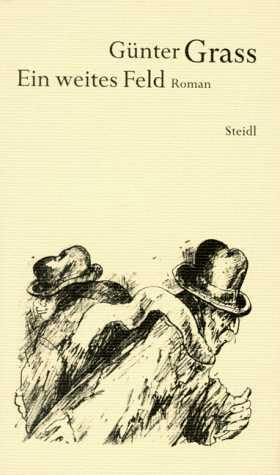![Ein weites Feld]()
Ein weites Feld
sich unser Vierklee, ein aus verschiedenen Kartenspielen gemischtes Quartett, auf den Weg macht, um mitzufeiern, zu jubeln, bloß um dabeizusein oder lustlos in der Menge zu schwimmen, müssen wir einiges nachtragen, damit bei dem raschen Ortswechsel – anfangs zu Fuß, später im Trabi – nichts liegenbleibt. Das Blatt soll neu gemischt werden - oder simpel gesagt: Es gefällt uns, Deutschlands Einheit ein wenig zu verzögern. Noch vor der familiären Ruderpartie hat uns Fonty mit seiner Enkeltochter besucht. Und schon bald nach dem Anschluß, der Beitritt genannt wurde, kam Madeleine ohne ihren Großvater ins Archiv, wie sie uns vor dem historischen Datum allein und studienhalber aufgesucht hatte. Diese Kontakte entsprachen dem seit gut zwei Jahren geführten Briefwechsel mit der Studentin, die zwar nicht, wie wir vermutet hatten, aus der Pariser Ecole Normale Supérieure hervorgegangen war, jener elitären Institution, an der Paul Celan bis in die sechziger Jahre hinein Professor gewesen ist, doch studierte sie immerhin an der Sorbonne und befand sich mitten in ihrer Magisterarbeit. Man könnte sagen, Madeleine Aubron gehörte zu unserem festen Kundenstamm: Wie in den Briefen, geschrieben noch während der Endphase der Arbeiter-und Bauern-Macht, ging es nach dem Fall der Mauer einzig um den Unsterblichen und dessen literarisches Umfeld, also um den Platen-, Lenau-, Herwegh-Club, die Dichtergesellschaften Tunnel und Rütli, ferner um Theodor Storm und dessen Potsdamer Zeit; auch waren ihr halbwegs oder gänzlich vergessene Literaten wie Alexis, Scherenberg, sogar Wildenbruch von Interesse. Über Preußens Adel, Marwitz voran, wollte sie mehr wissen, als bei uns zu finden ist. Sie fragte nach dem Einfluß von Turgenjew und Bürger. weniger nach dem der erklärten Vorbilder Scott und Thackeray. England blieb ausgespart, so der Fall William Glover und die geschmierte Zeitung »Morning Chronicle«: wohl aber waren ihr Freundschaften mit Wolfsohn, Lepel, Heyse wichtig, desgleichen Gottfried Kellers Spott auf die preußischen Manieren der im Tunnel über der Spree versammelten Verseschmiede. Anfangs fragte sie nach den frühen, wie wir inzwischen wissen, verschollenen Gedichten der Dresdner Zeit, später konzentrierten sich ihre schriftlich, dann mündlich gestellten Fragen auf die Magisterarbeit, der die sogenannten Berlinromane Futter genug gaben. Wir -das sei zugegeben – bewunderten ihren Ernst, ihre in heutiger Zeit ein wenig altmodisch anmutende Wissenschaftlichkeit, aber auch ihr von Logik bestimmtes Urteil, dessen Schärfe manchmal von gefühligen Einsprüchen, nein, eher vom plötzlich mitredenden Gefühl gemildert wurde. Nicht verschwiegen soll werden, daß ihr Charme, vom ersten Besuch an, das Archiv verzaubert hat. Man könnte sagen, Madeleine hat ein wenig Esprit in unsere trotz aller internationalen Korrespondenz noch immer realsozialistisch verengte Bude gebracht. Sobald sie eintrat, kam etwas vom Geist des Unsterblichen über uns; von den Töchtern des Grafen Barby sprach weniger die Komtesse Armgard, wohl aber die Gräfin Melusine aus ihr, und gleichfalls hörte sie sich wie die bürgerlich aufsässige Corinna an. Sie redete wie gedruckt und war fast so zitatsicher wie unser Freund Fonty; deshalb waren wir nicht besonders erstaunt, als sie plötzlich an dessen Arm das Archiv besuchte. Das war an einem der letzten Septembertage. Sie trug ihr vom Gürtel gerafftes Kleid aus schlicht zugeschnittener Rohseide wie eine elegante Kutte. Er war, wie immer, mit einem Blumengebinde zur Stelle: knospende und zart aufgehende Dahlien. Aus Fonty sprach unverkennbarer, wenngleich ironisch überspielter Stolz, als er die uns bekannte Studentin »meine mir spät geschenkte Enkeltochter« nannte und hinzufügte: »Aber Vorsicht, meine Damen und Herren! Madeleine ist nicht nur klug und belesen, sie ist auch von widerborstigem Reiz oder – um Ihnen Geschmack zu machen – wie zartbittre Schokolade. Wette, daß Sie bereits gekostet haben.« Als sie uns mit diesem haftenden Etikett vorgestellt wurde – heftig verlangte Fonty später, als seine Enkeltochter längst abgereist war, nach der ihm fehlenden »zartbittren Person« –, lächelte Madeleine Aubron bei ernst bleibendem Blick und sagte: »Mein Großpapa neigt dazu, alles auf den Punkt zu bringen, etwa wie Botho von Rienäcker die sein Standesbewußtsein verwirrenden Gefühle auf den Punkt brachte: ›Ordnung ist Ehe!‹ Voilà, wenn Ordnung so kurzgebunden zu
Weitere Kostenlose Bücher